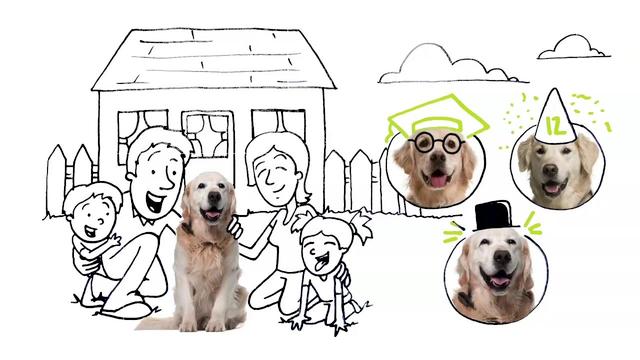Dieses historische Foto zeigt den Zoo inmitten eines fast unberührten Neuenheimer Feldes. Das Bild stammt vermutlich aus den Gründerjahren des Tiergartens – noch vor dem Zweiten Weltkrieg. Foto: Zoo
Kapitel 1: AltstadtAußer gewöhnlichen hat die Stadt noch außergewöhnliche Einwohner. Die Geistesgrößen und Geisteskranken. Die einen sind nobiliert bis zum Nobel-Preis, der Stolz der Stadt und bekannte Namen: Hell, Hausen, Hessler. Nobelpreisträger zu würdigen ist einfach. Sie sind etikettiert durch das Stichwort ihrer prämierten Forschungsergebnisse. Hessler hat den kältesten Kühlschrank der Welt gebaut. Von den Verrückten weiß ich nicht mal den Namen.
Bei einer Luxation springt der Knochen ruckartig aus seinem Gelenk. Je nach Schwere der Verrenkung rastet das Glied vollständig und dauerhaft aus der Gelenkpfanne. Bänder und Muskeln können das herausgesprungene Glied nicht wieder zurück ins Gelenk zwingen. Im leichteren Fall springt es von selbst in seine ursprüngliche Position zurück. Ein ausgerenktes Glied ist Folge einer äußeren Krafteinwirkung. Ein heftiger Pressschlag oder ein ungebremster Zusammenprall. Im Sportunterricht habe ich oft genug damit zu tun.
Die Verrückten kommen aus ganz normalen Familien. Manchmal sind es gleich zwei oder drei, die aus der Reihe tanzen. Weil sie es zu Hause nicht aushalten, zeigen sie sich in der Öffentlichkeit. Lebende Sehenswürdigkeiten der Stadt.
Das Pferdegesicht trabt seit Jahren rastlos durch die lange, schnurgerade Hauptstraße. Sie hat mit uns studiert. Ihr Verstand scheute vor den Prüfungen und ist mit ihr durchgegangen. Und nicht wieder zurückgekommen. Ich weiß nicht, ob sie noch immer in dieser Angst lebt. Anfangs hat sie eine Mark verlangt. Den Euro hat sie nicht genommen. Sie hat uns beschimpft, wir würden ihr Falschgeld geben. Jetzt geht sie durch die Hauptstraße zum Uni Platz. Sie spricht keinen mehr an und fragt auch nicht mehr nach einer Mark. In der Cafeteria am Uni-Platz verzieht sie sich in die Damentoilette und macht sich frisch. Dann geht sie weiter den ganzen Tag über die Hauptstraße auf und ab. Wo sie über Nacht bleibt, weiß ich nicht.
Ein altes Ehepaar haust im Schutz der Alten Universitätskirche. Sie führen ihren ganzen Besitz bei sich. Sie verwahren ihn, wie unsere Großeltern verwahrt haben. In einem überladenen Einkaufswagen führen sie ihn über die Plöckstraße die Grabengasse runter zum Uni-Platz. In den Sommermonaten verlassen sie nicht ihren Wohnplatz in zwei Nischen der südlichen Kirchenmauer. Die Frau macht Ordnung im Haushalt. Er sitzt auf der Bank und liest. In den kalten Monaten sehe ich sie nicht mehr im Schatten der Kirche. Wo sie in den Winternächten sich aufhalten, weiß ich nicht. Sie kommen morgens mit Hab und Gut angerollt.
Die Frau im Kleinen Weißen ist sommers wie winters braun gebrannt, als käme sie frisch aus dem Sonnenstudio. Der scheue, schmale Mann überlässt der Frau in Weiß seine Zeitung, sobald er sie ausgelesen hat.
Der Lange trägt immer ein Sakko überm Hemd und Krawatte. Seine Haare sind schulterlang. Er gilt als Professor. Er wohnt in unserem Viertel. Manchmal nehmen wir denselben Bus. Hat einige Fahrten gedauert, bis wir uns stumm grüßen, wenn wir an der Haltestelle warten. Er kommt aus einem anderen Fußweg auf die Berliner hinaus. Seine Frau schickt ihn morgens aus dem Haus.
Die unscheinbare Graue gönnt sich nicht mal ein stummes Kopfnicken. Sie bringt nichts mit als ihren winzigen Körper und ein klein wenig Aufmerksamkeit. Zum Frühstück hat sie nie etwas dabei und ist nach wenigen Minuten eingeschlafen. Weiß nicht, ob vor Hunger oder weil sie nachts nicht schlafen kann. Ihr Kopf sinkt auf die Arme. Sie versteckt sich hinter einer Säule. Ab und zu zeigt sie sich kurz, schaut um sich, für einen Augenblick scheint sie neugierig.
Die Verrückten sitzen in der weiträumigen, noch leeren Cafeteria ruhig an unseren Tischen. Wir verteilen uns leise. Jeder bleibt für sich. Jeder hält Abstand. Ganz selten geht einer rüber. Vielleicht um zu schnorren.
Viertel nach sieben kommen die ersten Schüler. An ein paar Tischen werden Hausaufgaben gemacht. Erst laut und aufgeregt. Dann still und konzentriert. Sie besuchen eine Grund-, Haupt- und Realschule gleich hinter der Cafeteria. Die nehmen sie als Abkürzung. Ein kurzes Lärmen. Im Gänsemarsch durchqueren sie die Cafeteria und verlassen sie durch den Westausgang. Dann kehrt wieder Ruhe ein.
Es ist das zweite Jahr, dass ich auf Ferien in der Schweiz verzichte. Meine Frau und die Kinder kommen im Engadin auch ohne mich zurecht. Sie haben den Hund mitgenommen. So sind die Kinder beschäftigt und streiten darüber, wer ihn an der Leine führen darf. Sie wollten unbedingt einen Hund. Der Hund ist kleiner und bleibt dauerhaft dümmer als sie. Axel wird dreizehn, Julia wurde gerade elf. Birgit ist Dozentin an der Gehörlosen-Schule und zuständig für die Ausbildung in Gebärdensprache. Ein wenig Gebärdensprache kann auch ich. Ich bin daheim geblieben und gönne mir diese familienlose Zeit. Im Fexer Wald Hotel würde ich immer nur an hier denken. Birgit ist eine geborene Ruppert und die dritte Generation. Einer ihrer Großväter hat das Haus in achtzehnhundert Meter Höhe gebaut. Seither gebietet uns der kaufmännische Anstand, einmal zwei Wochen dort zu verbringen. Ich ziehe ein kleines Häuschen im Walde vor. Zugegeben, der Blick über den Silser See ist atemberaubend.
Ich heiße Michael Zimmermann. Werde aber Hannes gerufen nach dem zweiten Taufnamen. Eigentlich sind es die dritten Großen Ferien, die ich den Verrückten opfere. Ich unterrichte an der Uni und habe zweimal im Jahr Große Ferien. Die Universität rechnet nicht in Jahren, sondern Halbjahren, den Semestern. Dazwischen gibt es unterrichtsfreie Zeiten.
Mich hat anfangs gewundert und wohl auch gestört, dass die Verrückten in die Mensa Uni eingelassen werden. Aber sie fallen nicht weiter auf. Auch die Blaumänner und die Männer in orangenen Sicherheitswesten, jeder auf seine Weise für die städtische Straßenreinigung zuständig, kommen noch vor den Studierenden und machen ihr zweites Frühstück. Darum gibt es zwei unterschiedliche Preise. Der Kaffee für Mitarbeiter der Universität und Studierende kostet 1,20 Euro; alle andern zahlen 1,60 Euro.
Inzwischen kenne ich alle vom Sehen. Und die Verrückten gehören dazu. Ich kann sie mir gar nicht mehr wegdenken. Sie verhalten sich ganz unauffällig. Die meisten. Das Ehepaar ist manchmal aggressiv, wenn sie ihre Ecke einnehmen und ihren ganzen Plunder unterbringen. Da verjagen sie schon einen, von dem sie glauben, dass er ihren Platz eingenommen hat. Aber generell sind alle friedlich. Auch die Neue! Sie ist nach mir dazugestoßen. Erst in meiner zweiten Saison. Sie hat ihren Platz im Rondell. Dort hat sie eine Steckdose für ihren Apple. Auf dem Präsentierteller genießt sie unsere Aufmerksamkeit. Das hatte sich bald abgeschliffen. Sie hat sich dran gewöhnt, dass keiner mehr gafft. Wir respektieren einander und verhalten uns ruhig. Auch sie fühlt sich jetzt hier wohl.
Das hat einen guten Grund.
In dieser Cafeteria dudelt kein SWR3. Darum ist hier der Treffpunkt für Studierende, die zusammen lernen wollen. Hier können sie beim Lernen essen und trinken und miteinander reden oder mal laut lachen. In der Bibliothek dürfen sie das nicht.
Das Leben ist eine einzige Anstrengung, sich von den Eltern zu unterscheiden. Nicht ein einziger von den Verrückten hat vor mir sein Leben ausgebreitet. Oder gar sein Herz ausgeschüttet. Keiner redet mit mir. Sie leben und schweigen. Obwohl ich, wenn auch nur sparsam, schon mal einen Kaffee oder was zu beißen spendiere. Immerhin haben sie meinen Sinn geschärft und mich auf Onkel Eugen und Cousin Werner aufmerksam werden lassen. Onkel Eugen erklärt dir das ganze INF. Und Cousin Werner predigt den Autos. Viele Menschen verirren sich in unserer Stadt und heben ab. Jeder braucht festen Boden unter den Füßen. So muss ich auch über Grund und Boden und ihre Besitzverhältnisse reden.Kapitel 2: Rundfahrt 1Die Stadt hat 241 Haltestellen. Mir genügen zwei. Die Haltestellen Neues Gymnasium und Technologiepark. Sie liegen am Anfang und Ende des Mathematikons an der Berliner Straße. Am Neuen Gymnasium steigen die Studierenden aus, wenn sie ins Mathematische Institut gehen. Am Technologiepark, wenn sie vorher noch etwas einkaufen wollen.
Beide Haltestellen liegen an Einfahrten zu den Instituten und Kliniken im Neuen Feld. Es gibt noch eine dritte Einfahrt ins INF gleich zu Beginn der Berliner Straße. Es ist das Endstück der Jahnstraße und führt zur Alten Chirurgie. Die mittlere Möglichkeit, um ins Neue Feld zu kommen, in Höhe der Haltestelle Neues Gymnasium, ist die Verlängerung der Mönchstraße. Beide queren die breite Berliner Straße. Die Einmündung bei der Haltestelle Technologiepark ist die gedachte Verlängerung der Blumenstraße. Die Blumenstraße ist die Grenze zwischen Altdorf und Neudorf.
Die Berliner Straße ist eine vierspurige Umfahrung dieser beiden Stadtteile. Eine baumbestandene Allee, Platanen glaube ich. Eine breite Umgehung mit einer Gleisanlage in der Mitte und Radwegen an den Seiten. Die Fußwege sind im Grunde überflüssig. Kein vernünftiger Mensch geht zu Fuß die Berliner entlang. Er nimmt die Straßenbahn. Sie ist kein Boulevard. keine Flaniermeile. Selbst an Sonn- und Feiertagen fehlen ihr die Fußgänger. Ohne den Berufsverkehr ist sie wie ausgestorben.
Die Berliner trennt das Terrain der Wissenschaft vom Wohngebiet. Es ist offensichtlich, dass keiner heil hinüber oder herüber kommt. Die Haltestellen an den Querstraßen, Jahnstraße, Neues Gymnasium und Technologiepark, sind die einzigen Übergänge von der Stadt ins Gelände der Institute und Kliniken. Die Berliner Straße ist eine Erinnerung an die Geschichte der deutschen Teilung nach dem Krieg. Mit Berlin hat sie nichts zu tun.
Ich bin Lehrer für Deutsch, Sport und Geschichte. Geschichte des Sports, der Literatur und der Geschichte eben. Und Brillenträger. Seit meinem sechsten Geburtstag verbringe ich mein Leben im Gehege einer Schule. Meinem Verkümmern habe ich mit einer Doktorarbeit entgegenzuwirken versucht. Sport unterrichte ich montags am Neuen Gymnasium. Am Studienkolleg unterrichte ich drei Tage die Woche bei vollen Bezügen. Wir führen Ausländer, deren Abitur bei uns nicht anerkannt wird, zur Hochschulreife. Ich habe mich freiwillig ans Kolleg gemeldet. Am Gymnasium hatte ich die Wahl zwischen der Mittelstufe mit den jedes Schuljahr wiederkehrenden Pubertätskrisen der Schüler. Oder der Oberstufe mit einer Abi-Klasse am Bein und den Erst- und Zweitkorrekturen der Aufsätze und ihren unsäglichen Debatten, um die passende Note zu finden. Am Kolleg erspare ich mir nicht zuletzt die Eltern und Elternabende.
Zwischen den beiden Haltestellen Neues Gymnasium und Technologiepark steht seit kurzem das Mathematikon. Die beiden Haltestellen liegen zwei Fußballfelder auseinander. Das Mathematische Institut hat keine eigene Haltestelle. Es lohnt nicht, Busse und Bahnen nach hundert Metern schon anzuhalten und gleich wieder anfahren zu lassen. Man erreicht es nördlich über die Haltestelle Technologiepark. Oder den Süd-Eingang beim Neuen Gymnasium.
Das Mathematikon besteht aus drei Gebäuden. Dem Mathematischen Institut und den beiden kommerziellen Trakten. Das Institut ist von den beiden bewirtschafteten Gebäuden durch eine Plaza getrennt. Sie hat einen Zugang zum Lift in die Tiefgarage, Bestuhlung für die Gartengastronomie und ein Wasserspiel, das die Gäste vom Autoverkehr der Berliner Straße abschirmt.
Diese Teilung des Mathematikons in ein Drittel Wissenschaft und zwei Drittel Kommerz zeigt sich auf den Briefköpfen in der Postanschrift und der Besucher-Adresse. So distanziert sich die Wissenschaft der Mathematik clever von Rewe, Aldi, Rossmann und der Sparkasse.
Der mathematische Teil des Mathematikons adressiert sich mit INF205. Die beiden kommerziellen Gebäude firmieren unter Berliner Straße mit den Hausnummern 41-49. Nicht allein, weil die Eingänge zu Praxen, Kanzleien und Büros zur Berliner hin liegen. Auf der Rückseite des Gebäudes, mit Blick auf die Institute der Umweltforschung, Geologie und Zoologie hin, setzt sich der kommerzielle Teil fort mit den Adressen Berliner Straße 51-53. Da befinden sich die Einfahrt zur Tiefgarage und die Rampen zur Anlieferung der Waren für den Supermarkt, den Discounter und den Drogeriemarkt. In den oberen Stockwerken residiert das Zementwerk, bis sein neues Flaggschiff am Beginn der Berliner, Ecke Jahnstraße, fertiggestellt ist. Mit dem Mathematikon ist die Bebauung der Neuen Felder, INF, an ihre Grenze gekommen. Es ist das Äußerste der Bebauung. Über die Berliner Straße weg ins Wohngebiet kann die Wissenschaft sich nicht ausbreiten. Die beiden Ortschaften waren der Wissenschaft zuvorgekommen und haben sich von Osten her bis an die Berliner herangebaut.
Von meinem Standort Haltestelle Technologiepark schaue ich über die Berliner und ihren rauschenden Verkehr hinweg nach Westen Ins Neue Feld. Manche sagen Neuer Campus. Denn wie die Felder soll er für den Autoverkehr geschlossen sein. Im Neuen Campus haben die Kliniken und Naturwissenschaften ihren Standort. Campus ist lateinisch und bedeutet Feld. Ob Feld oder Campus, dafür gibt es keine zwingende Vorschrift von Seiten der Universität.
Die Universität gehört nicht der Stadt, sondern dem Bundesland, in dem die Stadt liegt. Das Land ist für eine Universität zuständig. Die Stadt stellt nur den Grund und Boden. Dafür muss nach der Bebauung das Land für den Unterhalt der Gebäude aufkommen. Auch fürs Personal, das dort arbeitet.
Altdorf, Neudorf und das Gelände der Wissenschaft INF gehören im Grund zusammen. Sie liegen auf einer Gemarkung. Neudorf und INF waren einmal die Felder und Äcker und Wiesen der Gärtner, Bauern und Landwirte von Altdorf. Ein Landwirt baut Getreide und Rüben an, ein Bauer hält Milchvieh und züchtet Schweine. Dann wuchsen Dorf und Stadt. Architekten planten und die Bauunternehmer setzten die Pläne um. Zwischen Dorf und Stadt bildete sich ein neues Wohngebiet, das neue Dorf.
Die Berliner Straße umfährt die beiden Dörfer, die heute Stadtteile sind. Das Geld der Landwirte und Gärtner hat nicht gereicht. Für Kanalisation und elektrische Straßenbeleuchtung mussten sie sich einstädtern lassen. Anders hätten Alt- und Neudorf auch keine Straßenbahn und keinen Busverkehr gekriegt. Ein Gemeinsames haben die drei aber. Ein Fluss trennt Altdorf, Neudorf und das INF von der übrigen Stadt. Zusammen bilden sie die Nordstadt.
Wenn ich den rechten Arm gerade ausstrecke, und dann auch den linken Arm, und ihn leicht beuge, sodass die Fingerspitzen der linken Hand den rechten Arm am Handgelenk berühren, dann habe ich ein Viertel von einem Kuchen vor der Brust. Es ist die Form des INF. Der linke Arm ahmt die Biegung des Flusses nach. Der gerade rechte bildet die Straße, auf der die Busse ins INF hineinfahren. Meine Brust ist die Berliner Straße. Vor meiner rechten Brust habe ich das Mathematikon. Nicht ganz mittig, links vom Brustbein, wären nichts als Parkplätze. Auch das Mathematikon war einmal ein Parkplatz. Ganz am Rande, auf der linken Schulter, säße die Einfahrt Jahnstraße mit dem MPI für Medizinische Forschung. Mit ihm hat alles begonnen. MPI steht für Max-Planck-Institut. Es ist die entpolitisierte Fassung der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft.
Mit ausgestreckten Armen verschaffe ich mir einen Überblick über das INF. Diesen Kniff mit den Armen habe ich von Onkel Eugen. Damit kann ich den Campus der Wissenschaften und Heilkünste Im Neuen Feld jederzeit und überall in meinem Vorstellungsvermögen aufrufen. Drehe ich mich so, egal, wo ich mich gerade befinde, dass die rechte Schulter nach Norden und die linke nach Süden ausgerichtet sind, dann stimmt mein Modell mit der Wirklichkeit auch topografisch überein. Topografisch sagt Onkel Eugen. Ich ziehe geografisch vor. Aber muss ihm recht geben.
Die ausgestreckten Arme vor Augen, das Wohngebiet Alt- und Neudorf im Rücken, warte ich an der Haltestelle Technologiepark auf den 31er Bus, der aus der Altstadt kommt. Er fährt eine 8 und über den Hauptbahnhof in die Altstadt zurück. Die Schleifen überschneiden sich im Stadtzentrum. Dort kommen bis auf die Linie 24 alle Busse und Bahnen vorbei. Die Linien 21, 22 und 26 und der 39er Bus enden und beginnen hier. Die Linie 24 bedient auch den Technologiepark. Sie fährt von der Endstelle Nordstadt die Berliner Straße entlang über den Bahnhof bis Endstelle Südstadt. Die Linie 23 beginnt auch Nordstadt Endstelle und fährt über Südstadt Endstelle hinaus. Jedoch durch die Stadtmitte und nicht die Berliner entlang und nicht am Hauptbahnhof vorbei. Aber das würde zu weit führen.
Der 31er ist pünktlich. Auf die Minute genau. Sowohl nach der elektronischen Anzeige als auch nach dem ausgedruckten Aushang im Wartehäuschen.
Es ist früh am Morgen und die Fahrzeiten haben sich noch nicht verschoben. Ich steige ein und fahre mit dem Bus auf der Straße Im Neuen Feld gegen den Uhrzeiger ins INF. Die Ampel ist so geschaltet, dass der Bus vor den Linksabbiegern der Berliner in die Straße INF, die gedachte Verlängerung der Blumenstraße, der Grenzlinie zwischen Altdorf und Neudorf, ins INF einfahren kann. Neun von zehn Autos biegen hier ab ins INF. Zu den Stoßzeiten in der Früh und am Nachmittag eine ganz verzwickte Sache. Nach Onkel Eugens Navigation befinde ich mich auf meinem rechten Schultergelenk.
Ich sitze am liebsten ganz vorn erhöht mit dem Panoramablick. Auf dem Sitz des Reiseführers. Heute sitze ich bewusst links, hinter der Kabine des Fahrers. Wie Onkel Eugen es mich bei der ersten Fahrt durchs INF geheißen hat. Vor mir habe ich nur das dunkle Glas, das den Fahrer von den Fahrgästen trennt. Vorn hinaus kann ich nichts erkennen. Ich bin gezwungen, den Kopf nach links zu drehen, wenn ich mir die Umgebung betrachten will.
Das erste Gebäude ist das Geologische Institut. Es hat ein verwunschenes Biotop mit hohen, dicht stehenden Bäumen und einem Röhricht um einen Teich, in dem nachts die Frösche streiten. Die Geologen interessieren so wenig wie das Nachbargebäude, das Uni-Rechen-Zentrum, kurz URZ. Die Gebäude der Geologen und der Informatiker liegen nebeneinander und haben die Hausnummern INF235 und INF293. INF ist der Name der Straße! und der Name des Geländes. Obwohl sie linkerhand liegen und ich immer nur links hinaus schauen soll, ignoriere ich sie. Die rechte Seite interessiert gar nicht. Rechts ist Altdorf, links Neudorf. Es ist unsinnig, die Einrichtungen der Uni rechts der gedachten Verlängerung der Blumenstraße die Anschrift Im Neuen Feld zu geben. Darum hat mich Onkel Eugen links gesetzt. Und tue so, als gebe es die ganze rechte Seite nicht. Weder die blass lilanen Wohnheime INF521, den Flachbau der Physik und Astronomie INF501, das neue Parkhaus INF507, das MPI für Internationales und Völkerrecht INF535, die Pädagogische Hochschule INF561-562, die Klinikverwaltung Admin INF672, die Zentralküche des Klinikums INF670, die Wohnheime INF674-683 – und mein Studienkolleg INF 684. Eins nach dem andern der Reihe nach aufgezählt. Zuletzt schon auf Eck gebaut noch ein Parkhaus INF699. Das alles zählt nicht. Ich blicke auch gar nicht rechts aus dem Bus, halte mich an Onkel Eugens Anweisung und habe alles im Kopf. Da ist Altdorf. Es waren Altdorfer Felder. Die PLZ darf ich nicht vergessen! Rechts, das heißt alles, was nördlich der Blumenstraße gebaut ist, liegt auf Altdorfer Gemarkung. Gemarkungsgrenzen gibt es auch heute noch. Etwa bei der Einschulung wird darauf geachtet. Oder beim Begräbnis. Altdorf hat die Postleitzahl 69121 und Neudorf 69120. Aber alles nördlich der INF-Straße, angefangen bei den blass lilanen Wohnheimen bis zum Parkhaus INF699 haben 69120, obwohl auf Altdorfer Gemarkung.
Diese Okkupation hat Onkel Eugen besonders aufgebracht. Als er von meiner Arbeit hörte im Kolleg in INF684 mit der PLZ 69120. Das Neue Gymnasium, an dem ich Sport unterrichte, hat berechtigterweise die 69120 im Briefkopf. Wobei der Unterricht draußen im Bundesleistungszentrum Olympiastützpunkt INF710 und nur einen Katzensprung vom Kolleg entfernt liegt. Also auf Altdorfer Gemarkung. Hat aber die 69120 von Neudorf im Briefkopf. Die Blumenstraße hieß vor der Bebauung Blumenweg. Sowohl diesseits wie jenseits der Berliner Straße sollte sie so heißen. Und anfangs so, und zum Ende INF-Straße. Die Postleitzahlen sind für die Stadtteile der Stadt, was die Nationalstaaten für den Kontinent.
Links lasse ich die Institute für Geologie und Informatik passieren. Danach fange ich an zu zählen. Die Kopfklinik ist die zweite Haltestelle und die erste Klinik im INF. Mit ihr beginnt der Ring der sieben Kliniken. Kopfklinik und gleich daneben die Zahnklinik teilen sich den Haupteingang und demzufolge auch die Gebäudenummer INF400. Das Nationale Centrum für Tumorforschung, NCT, springt hoch auf die Adresse INF460. Jetzt kann ich von meinem Fensterplatz aus schon die farbenfrohe Kinder- und Jugendklinik zu sehen, INF430. Nach diesen drei Einrichtungen der Universität und drei Haltestellen sind wir schon ans Ende dieser geraden INF-Straße, die den Verkehr durch den Campus leitet, angelangt. Sie misst einen Kilometer.
Die INF-Straße stößt in Höhe der Spielfelder der beiden Rugby-Clubs auf die Tiergartenstraße. Altdorf hat den TSV und Neudorf den SC. Sie haben Spieler aus Südafrika, Neu Seeland, Argentinien und Gott weiß, woher. Es spielen auch Neudorfer im TSV und Altdorfer im SCN.
Der Tiergarten ist Namensgeber der Straße. Ortsunkundige fassen wieder Vertrauen, dass sie auf dem richtigen Weg sind. Aber der Tiergarten liegt rechter Hand. Und somit nicht Im Neuen Feld, sondern außerhalb. Darum interessiert er uns nicht. Aus gutem Grund schreibt der Tiergarten sich heute Zoo. Beim Schreiben erspart das sieben Buchstaben.
Wir sind auf Onkel Eugens Armmodell bei den Händen angekommen. Wo die Fingerspitzen der linken das Gelenk der rechten Hand berühren. Vielleicht ist der Punkt auch schon vom rechten Handgelenk auf die Fingerspitzen der linken Hand übergesprungen.
Bevor der 31er Bus links ab in die Tiergartenstraße einbiegt, muss ich etwas klarstellen. Seit der Haltestelle vor der Kopfklinik sind wir im 32er Bus unterwegs. Keinem Fahrgast ist es aufgefallen. Niemand musste umsteigen. Der Fahrer des Busses sagt es nicht an. Nur wer aufmerksam oder ängstlich das Display an der Decke liest und die Haltestellen verfolgt, dass er richtig aussteigt, erkennt links oben in der Ecke eine 32. Da steht seit der Abfahrt in der Altstadt bis hier heraus Anfahrt Haltestelle Kopfklinik die 31. Und die Anzeigen am Bus draußen sind auch umgesprungen. Jeder kann aussteigen und sich an der Haltestelle Kopfklinik selbst überzeugen. Oder auf den nächsten Bus warten. Er kommt als 31er an und fährt nach einer Minute als 32er weiter. Dieser Wechsel bei INF400 wird in Onkel Eugens Modell in der rechten Armbeuge vorgenommen.
Wir sind Fahrgäste des 32er und es geht auf der Tiergartenstraße weiter Richtung Zoo. Die erste Haltestelle nach dem Einbiegen heißt Jugendherberge. Wer in die Kinder- und Jugendklinik muss, steigt da aus. Die automatische Ansage lautet "Jugendherberge. Zugang zur Kinderklinik, Frauen- und Hautklinik". Die drei Kliniken liegen in der Tiergartenstraße direkt nebeneinander, tragen aber die Gebäudenummern INF430 und INF440. Eugen wusste keine Antwort darauf, warum Frauenklinik und Hautklinik sich eine Hausnummer teilen. Am besten, man fragt den Busfahrer.
Wir fahren diese Straße zum Zoo langsam weiter. Vorbei an Haut- und Frauenklinik INF440, Neue Chirurgie INF420 sowie Innere Medizinische INF410. Sie liegen linkerhand entlang der Tiergartenstraße, also im INF. Und nicht außerhalb, wie der Zoo, die Jugendherberge und die Felder der Rugby-Clubs SCN und TSV. Ihre Besucher- und Postanschrift ist die Tiergartenstraße. Gegen unsere Fahrtrichtung beim Zoo angefangen aufwärts die Nummern 3, 5 und 7. Eine Hausnummer 1 gibt es nicht mehr. Der Tennis Club liegt jetzt am Nonnenpfad. Meine Kinder nehmen dort ihre Stunden. Ich erinnere mich an den Hype um seine berühmteste Spielerin. War wohl gerade aufs Gymnasium gewechselt. Mit sechzehn hat sie Wimbledon gewonnen. Sie lebt in Las Vegas. Der HTC war Tiergartenstraße 1. Jetzt ist hier Brachland. Müßig, zu spekulieren, wem es gehört.
Ich drehe ein dutzend Mal die 9 in meinem Mund wie ein hartes Bonbon. Dann erinnere ich mich. Die Anlage der TSG 1878 ist Tiergartenstraße 9-11. Dann das Tiergarten-Schwimmbad ist Nummer 13. Und dann käme auch schon das Ende. Der Springer Verlag. Spektrum der Wissenschaft. Nach der Nummer 15-17 beginnen die Schrebergärten, Hundeschulen, Baumschulen, Gärtnereien, Gemüseanbau, Spargel, Erdbeerfelder. Gerade Hausnummern gibt es die ganze Tiergartenstraße lang keine. Stattdessen ist auf der andern Seite alles INF. In Höhe des Tiergarten Schwimmbads etwa das Olympia-Zentrum, INF 710. Wo ich montags Sport unterrichte.
Das Erlebnis meiner ersten Rundfahrt mit Onkel Eugen hat sich tief eingeprägt. Auch jetzt hilft er mir wieder. Ohne ihn würde ich an einem mir unbekannten Ort leben. Obwohl ich hier geboren und aufgewachsen bin. Die Großeltern haben mich aufgezogen. Die Grund-Schule habe ich hier besucht, dann das Gymnasium, an das ich zurückgekehrt bin, um den Schülern etwas Beine zu machen, dass sie sich bewegen. Morgens fahre ich ins INF zum Kolleg, INF684. Ich habe hier geheiratet, die Kinder sind zur Welt gekommen. Ich wüsste nichts über meine nächste Umgebung, in der ich lebe. Eugen hat mir die Sinne geschärft und den Sinn fürs Ganze. "Die Altstadt kann jedes Kind!" Sagt er spöttisch. "Jedes Kind kann sie dir zeigen. Hier draußen, wo die Musik des Lebens in den Kliniken spielt, braucht es einen Alten." Eugen lacht lieber, als dass er schimpft.
Mit dem rechten Zeigefinger tippe ich an den linken Ellenbogen. Da sind wir.
Ich lasse die Gebäude der Kliniken vor dem inneren Auge noch einmal passieren. Angefangen hat der Ring der Kliniken mit den Gebäuden INF 400, 460, 430, 440, 420 – in dieser Reihenfolge – wir halten gerade vor der 410. Um die letzte Stelle, die Null, gekürzt, habe ich gewöhnliche Hausnummern wie in jeder Straße, 40, 46, 43, 44, 42 und 41. Jetzt fällt das Durcheinander erst richtig ins Auge. Und die 45 fehlt völlig. Onkel Eugen hat mich aufmerksam gemacht. Von wegen links die Geraden und rechts die Ungeraden. Im Klinik-Ring stehen die Gebäude schön der Reihe nach beieinander. Dafür tanzen ihre Nummern wild durcheinander.
Die Innere Medizinische INF410 ist mit der Kopfklinik INF400 durch eine gläserne Brücke überirdisch und durch ein Tunnel unter der Erde verbunden. Womit der Klinik-Ring geschlossen wurde. Es wäre eine Illusion, dass Patienten und Besucher um diesen Kreis der Kliniken herumfahren könnten, bis sie die richtige gefunden hätten. Es gibt keine Verbindung für den Publikumsverkehr zwischen Tiergartenstraße und INF-Straße. Dass sie fehlt, ist der Idee des Campus geschuldet. Dem Gedanken des Feldes, auf dem die Wissenschaft ungestört gedeihen soll. Vor der Medizinischen Klinik halten wir etwas länger. Die geschlossene Schranke gibt mir Zeit und Gelegenheit. Ich will sie nutzen.Kapitel 3: EugenHier sind wir ausgestiegen.
"Du hast doch Zeit mitgebracht!"
Onkel Eugen schiebt mich hinaus.
Wir lassen den Bus sausen. Ich schaue ihm hinterher. Eugen schaut sich um. Er murmelt etwas vor sich hin. Dreht sich links, nach rechts, schaut zurück, schaut voraus, der Bus ist längst außer Sichtweite. Dann hüpft er auf einen Prellstein. Eugen reißt sich die Stetson-Mütze vom Schädel und wedelt teufelswild in der Luft herum. Wie in Matthäus 4,8 der Teufel versucht, dem Gottessohn die Schönheiten der Welt vorzuführen.
"Der Garten wurde vor hundert Jahren aus der Stadt hier herausverlegt. Das INF gab es nicht mal auf dem Papier. Ein neuer Campus war aber schon im Visier.
Mach die Augen zu! Stell dir vor, es gibt nur den Botanischen Garten und nichts drum herum. Nur Felder, Äcker und Wiesen. Manchmal verwildert und Streuobstwiese."
Ich mache die Augen zu und schiebe alle Bauten beiseite. Denke mir den Garten ohne Klinikum und ohne Gebäude. Der Botanische Garten mittendrin in den Feldern.
"Im freien Feld." Hilft Eugen nach. "Hast du’s?"
"Mutterseelenallein". Spotte ich.
"Wenn dir danach ist, stell meinetwegen noch ein paar Holzschuppen auf. Für jedes Gewann einen. Wenn die Nachbarn sich vertragen haben, genügte einer, wo sie ihre Ackergeräte, Pflug, Egge und so Bauernsachen unterstellten."
Ich hielt die Augen geschlossen und habe in Sichtweite einen, zwei Holzschuppen auferstehen lassen. Weiträumig um die Gartenanlage des Botanischen Gartens. Und noch einen dritten.
"So war das hier ein halbes Jahrhundert lang. Du sollst nicht mogeln! Lass die Augen zu!"
"Ich mogle nicht." Sage ich. "Vor meinem inneren Auge sehe ich nur den Botanischen Garten und die Felder drum herum mit ein paar Hütten drauf."
Eugen wartet und wiederholt nur zwei-, dreimal: "Halt schön die Augen zu!"
Ich warte, die Augen zugekniffen, die von selbst aufgehen wollen.
"Hast du ́s?"
Ich nicke mit zuenen Augen.
"Jetzt räume deine Schuppen vom Feld. Und stelle alles, wie es heute ist, wieder an seinen Platz. Aber ordentlich!"
Ich räume die Geräteschuppen von den Äckern. Eugen lässt mir ein paar Atemzüge Zeit.
"Alles in Ordnung. Die Schuppen sind weg! Deine Gebäude stehen wieder auf ihrem Platz."
"Kannst die Augen aufmachen."
Ich öffne die Augen. Ich reibe sie ein wenig mit den Handrücken.
"Und jetzt?"
"Lass uns was laufen. Hast hoffentlich Zeit mitgebracht!"
Wir gehen über den Vorplatz auf die Innere Medizinische zu, lassen den Eingang links liegen, biegen rechts ab der Bambuswand entlang um das Ende des Botanischen Gartens herum.
"Warum ist der Garten so abgeschrägt, nicht gerade und rechtwinklig? Ein Feld ist doch immer ein Rechteck."
"Meistens, aber nicht immer."
"Hat das mit der Klinik zu tun?"
"Das war schon vor dem Botanischen Garten so. Wegen der Güterbahn. Der Botanische Garten ging bis zu den Schienen der Güterbahn. Die lief quer durch die Felder, vom Steinbruch bis hierher zum Fluss. Dort wurde auf Schiffe umgeladen. Vielleicht wurde doch für die Klinik ein bisschen was weggenommen. Viel kann es aber nicht sein."
Dann gehen wir ein paar Schritte weiter.
"Auf einem frühen Lageplan kann ich sie dir mal zeigen. Das untere Stück ist ganz zugebaut. Wenn du am neuen Tennis-Club rechts vorbei gehst, siehst du die Trasse. Sie geht quer durch die Schrebergärten. Ein Stück kannst du sie noch sehen. Nein! Die Schienen sind längst weg. Wurden im Krieg gebraucht. Oder zum Wiederaufbau."
"Eine Güterbahn?"
"Die Linie 5 hieß früher OEG, die hatte die Trasse separat angelegt, dass der Personenverkehr und der Gütertransport sich nicht behinderten."
Wir bleiben stehen, wo die Zufahrt zur Mensa einen rechten Winkel macht. Sie kommt von der Straße INF, biegt vor der ersten Klinik links ab. Rechts die Kopfklinik und die Innere Medizinische. Ein großes L, der lange Strich ist gefühlt einen halben Kilometer lang, der kurze Strich, ein Fußballfeld, oder anderthalb. Den gehen wir ein Stückchen. Von weitem sehe ich einige Lastwagen, die an den Rampen entladen werden. Wir gehen auf der Zufahrt der Lieferanten der Mensa ein paar Schritte.
"Pass auf die Bodenschweller auf."
"Da ist der Eingang." Ich zeige auf ein niederes Türchen, das in den Botanischen Garten führt.
"Vielleicht später."
"Gehen wir dort rüber, bis unter das Gebäude!"
Wir gehen unter die Passage. In der Mitte hält er an.
"Die Pharmazie." Eugen verkündet es wie eine letzte Wahrheit. "Das Gebäude INF364 ist Teil vom Zentralbereich. Das erkennst du an der 3 am Anfang. Lass uns die paar Schritte weiter hineingehen. Hast du deine Schritte gezählt?"
Ich schüttle den Kopf.
"Dann gehe zurück und tue es!"
Ich gehe zurück zur Gartentür.
"Mach ganz normale Schritte!" Ruft er über den Weg mir zu. "Keine Siebenmeilenstiefel!"
Ich achte auf meine Schritte und zähle. Als ich bei Eugen ankomme, sagt er: "Bis hierher war mal alles Botanischer Garten. Bis mitten unter die Pharmazie."
"Dreiundvierzig Schritte."
"Weiß ich doch!"
Dann gehen wir aus der Passage unter der Pharmazie hinaus und zurück auf die Zufahrt.
"Gehen wir vor zur Mensa!"
Wir gehen langsam die Zufahrt für Lieferanten der Mensa entlang. Eugen stampft immer wieder mit dem Fuß fest auf den Boden, dass es knallt.
"Alles Botanischer Garten!"
Keine drei Schritte weiter.
"Botanischer Garten! Bester Boden! Bester Botanischer Gartengrund! Mutterboden unterm Pflaster. Schade drum! Allerbeste Muttererde."
Ich schaue kurz über die niedrige Hecke in den Garten hinein. Ein hoher Nadelbaum mit breiter Krone und hängenden Zweigen wie eine Trauerweide.
"Eine Zeder. Aus Nordafrika." Sagt er.
Ich schüttle den Kopf.
"Eine Atlas-Zeder. Eine Zeder aus dem Atlasgebirge."
Auf diesem breiten Weg kommt uns ein Lieferwagen entgegen. Wir brauchen nicht zur Seite zu gehen.
"Das reicht für zwei!"
Ich gehe an den Zaun des Gartens und schaue in das Bassin, gleich neben der Zeder.. Schmale Bretter, die am Rand aufliegen, ragen aus dem Wasser.
Ch drehe dem Garten den Rücken zu und schaue den Gebäuden entlang und hoch, und suche ihre Nummern.
"344, 324. Was ist da drin?"
"364, die Pharmazie. 344, die Infektion. 324, die Tropenhygiene."
Die INF344 ist ein glatter schwarzer Block. Ich zeige darauf hin.
"Wie die Kaaba von Mekka." Sage ich. "Davor steht ja ein Baum! Ein Riese!" Ich bin ganz aufgeregt. "Siehst du? Er ist höher als das Gebäude!"
Eugen lacht.
"Der gehört doch in den Garten hinein!
"Alter Bestand. Haben wir stehen gelassen. Zum Andenken."
"Ein Prachtbaum! Und er war bestimmt nicht auf Kante gesetzt. An den Rand."
"So weit ist die Fläche vom Botanischen Garten gegangen. Noch ein Stück weiter." Dann packt Eugen sein kleines Restchen Schülerlatein aus. "Quod erat demonstrandum!"
"Der lebende Beweis! Ein einziger, ganz allein. Und ein richtiger Mammut! Seit hundert Jahren. Man hätte ihn umpflanzen sollen, reinholen zu den andern!"
"Fünfzig Jahre sind das! Keine hundert! Aber hundert Jahre alt und älter!" Eugen sagt es streng. "Hundertjährige gibt es noch mehr."
"Scheint kerngesund! Was ist das wirklich für einer? Für einen Mammutriesen viel zu schlank. Die Rinde rissig, wie eine Kiefer. Man kann Schiffchen draus schnitzen."
"Eine Sequoia gigantea. Ein Nadelbaum ohne Nadeln. Mit einer weichen, rötlichen Borke und einem hohen, schlanken Wuchs."
Wir beruhigen uns. Ich lese noch mal die Nummern der Gebäude der Reihe nach. Von links nach rechts. 364, 344, 324.
"304 fehlt!"
"304 ist die Mensa dort vorn." Sagt Eugen.
Wir weichen der Mensa aus und zwängen uns durch, zwischen Mensa und Theoretikum. So kommen wir auf die Plaza. Wir gehen weiter zwischen den kleinen Platanen in Gittern durch.
"Die kommen gar nicht voran!" Sagt Eugen im Vorbeigehen.
Dann bleibt Eugen stehen. Bin etwas überrascht.
"Da ist schon die Berliner Straße."
"Zwei Minuten. Wenn du nicht trödelst."
Links der Eingang zum Mathematikon. Mathematisches Institut. Aus diesem Winkel schwierig zu lesen.
"Da drüben ist deine Schule." Sagt Eugen. Er deutet mit ausgestrecktem Arm voraus. Man sieht nur den Trakt mit den Sporthallen. Gegen den Verkehrslärm sind die Klassenzimmer nach hinten gebaut, entlang der schmalen, ruhigen Nebenstraße. Der Pausenhof liegt zur Berliner hin. In der Pause wird gelärmt. Danach ist wieder Ruhe. Links die Tankstelle.
"Die Mönchstraße. Wir schauen ihrem Ende her in sie rein."
Eugen erklärt. Als wüsste ich überhaupt nichts.
"Hier stehen wir auf dem alten Mönchweg. Als ich ein Kind war, waren hier noch die Felder."
Eugen zeigt vor sich auf den Boden. Dann dreht er sich um, ich ihm nach, und zeigt auf die riesige 306 ganz oben am Theoretikum.
"Geradeaus, quer Feld ein, mitten durchs Theoretikum. Zwischen den Stelzen durch. Etwas nach links hin zum Botanischen Garten heute, aber unter den Stelzen durch. Das war die Mönchstraße. Ein unasphaltierter Feldweg. Wir sind mit den Rädern auf dem Mönchweg zum Sport auf den Sportplatz TSG 78 raus gepeest, dass es gestaubt hat."
Er fuchtelt mit den Armen. Versucht mir die Verlängerung der Mönchstraße durchs INF klarzumachen. Keine Ahnung, wie ich peesen schreiben soll. Kommt wohl von pace, die Geschwindigkeit. Also gepacet. So in der Art. Es klingt peesen, nicht päsen.
"Der Mönchweg versickert wie die Donau im Ried. In meinem Kopf geht der alte Weg unter den Gebäuden fort. Vor der Medizinischen taucht er wieder auf, wo jetzt die Bambusse stehen. Aber nicht so eng. Wo er in die Tiergartenstraßen übergeht. Alles hat Mönchweg geheißen. Die Mönche waren früher als der Tiergarten in den Feldern. Kein Kloster. Ein Gutshof und die Hälfte von den Äckern haben den Mönchen gehört."
Onkel Eugen redet sich in Eifer darüber, was früher alles gewesen sei. Nicht besser, aber anders, und Fakt. Er streckt seine Arme hier hin, und dort hin. Er gehörte zu aus den ersten Jahrgängen im Neuen Gymnasium. Dunkel erinnere ich mich. Aber das würde zu weit führen. Das wichtigste einer Schule sei der Schulhof. Daran erinnere ich mich. Dass hier mal Äcker und Wiesen lagen. Ja, natürlich, auch hier wurde auf Felder und Wiesen gebaut. Wir müssten mal die Pläne anschauen, die liegen alle im Amt im Archiv. Die will er mir zeigen. Er packt mich am Ärmel, als wolle er mich auf der Stelle dahin schleifen. Sind doch nur ein paar Schritte. Dahin, zeigt er. Das gehen wir mit Links. Ich schüttle ihn ab.
Eugen zeigt und redet und hört gar nimmer auf. Müsste ihn mal an den Bus erinnern! Und schlucke es dann doch runter. Ich bringe es einfach nicht übers Herz, ihm diese Freude an der Vergangenheit zu nehmen. Also ich ihm immer folgsam und voller Eifer hinterher, wie beim Snooker der Schiedsrichter dem Spieler.
Auf der Plaza stehen kümmerliche Platanen mit Gitterschutz. Wir drehen uns um und stehen vor dem imposanten Gebäude. Ich lese die Inschrift hoch droben. Theoretikum.
"Hier beginnt der Zentralbereich." Sagt Eugen.
"Schwierig, sich zurechtzufinden."
"Alles bestens nummeriert."
"Ganz schön wuchtig."
Wir stehen und schauen uns die gewaltige Festung an. Sie droht jedem Ankommenden. "Eine feste Burg ist unser Gott!" Kommt mir in den Sinn. Ich stehe betreten neben Onkel Eugen. Als hätte ich etwas angestellt. Bin mir doch keiner Schuld bewusst. Minuten, die sich als Ewigkeit anfühlen. Reden hilft immer. Oder sich bewegen, dass die Gedanken von selbst abfallen.
"Neben dem Theoretikum wirkt die Mensa wie ein Sommerpavillon." Gleich legt Eugen sich mit neuem Feuereifer ins Geschirr.
"Du siehst nur richtig, wenn du es verstehst." Er gestikuliert und wackelt mit dem Kopf und strampelt mit den Beinen.
"Auf neun Hektar stehen im Zentralbereich zwanzig Gebäude. Die meisten fünf Stockwerke hoch. Wuchtig und doch luftig durch die Höhen. Der ZB ist kompakt. Verdichtetes Bebauen von Anfang an.
Arkaden und Laubengänge verbinden die Gebäude.
Die zwanzig Gebäude stehen eng beieinander, und doch mit gehörigem Abstand. Wie eine Schafherde. Natürlich kann ein Gebäudehaufen nicht auseinanderlaufen."
Eugen schaut mich an, lacht. Dass ich mitlachen soll. Aber ich will nicht.
"Wie ein Bild von einer Herde von Schafen. Da bewegt sich auch keins. Und die Gebäude sind gigantische Exemplare von Schafen. Wie sie Gulliver auf seinen Reisen zu sehen bekommen hat."
"Eigentlich und in Wahrheit ist der ZB gar nicht das Zentrum. Nicht wie der Kern in einer Zelle."
Ich kucke ihn verdutzt an.
"Meinetwegen. Die Rosine im Rosinenweck. Wenn dir das hilft."
"Der Zentralbereich der Medizin liegt nicht in der Mitte umgeben von sieben Kliniken. Der Ring der sieben Kliniken ist nicht um den Zentralbereich Neues Medizinisches Theoretikum gelegt. Klinik-Ring und Zentralbereich liegen nebeneinander. Sie stoßen da aneinander, wo die Einfahrt zur Rückseite der Mensa führt. An dem Knick vom großen L haben wir gestanden. Eine Berührungslinie von Ring und Zentralbereich auf einer Geraden von 300 Metern Länge.
Im Grunde ist der ZB sehr systematisch aufgebaut.
Den Botanischen Garten entlang verlaufen die Gebäude mit der Endziffer 4. INF364, INF344. INF324 und INF304, von Pharmazie bis Mensa.
Darüber liegen die Gebäude mit der Endziffer 5. Und so weiter bis hinauf zur 8. Da wir von links nach rechts und von oben nach unten lesen sind die Gebäude im Zentralbereich so angeordnet, dass wir den Lageplan ganz unseren Lesegewohnheiten entsprechend sehen und uns gut orientieren können. Und oberhalb der Reihe mit der Endziffer 8 verläuft der Kirschblütenweg.
INF368, INF348. INF328 und INF308.
INF367, INF347. INF327 und INF307.
INF366, INF346. INF326 und INF306.
INF365, INF345. INF325 und INF305.
INF364, INF344. INF324 und INF304.
Der Botanische Garten begrenzt den Zentralbereich unten. Der Kirschblütenweg oberhalb. Du kannst jetzt sehr schön erkennen, wie der ZB sich gliedert und wie er gedacht ist."
Ich weiß noch nichts von Flurnamen, Gewannen und den Einträgen im Lagerbuch des Grundbuchamts. Habe noch nicht das Bild im Kopf, wo die Gewanne liegen und wie die Gewanne verlaufen; von Nord nach Süden. Heute weiß ich Bescheid. Der Zentralbereich begräbt die südlichen Kirschbaumäcker unter sich. Der Ring der Kliniken beginnt in den nördlichen Kirschbaumäckern und endet in der Langen Furche. Ich hätte es Onkel Eugen ins Gesicht gesagt. Und sage nur:
"Eine Betonwüste. Ein fünfstöckiger Berg aus Beton. Ein hässlicher Klotz."
"Darüber lässt sich nicht mehr streiten. Gebaut ist gebaut! Die Nummern der Gebäude! Sie gehen von unten nach oben. Von 4 bis 8. Und von rechts nach links. In 20er Schritten. Die unterste, südliche Gebäudereihe beginnt bei 04 und setzt sich fort mit 24, 44 bis 64. Oder wie wir zu lesen gewohnt sind, die Nummern der Gebäude links nach rechts, in Natur von West nach Ost, 64, 44, 24, 04. Das wiederholt sich fünfmal, nur dass die letzte Ziffer ansteigt und raufgezählt wird, 4, 5, 6, 7, 8."
"Ganz schön hässlich, diese Klötze. Diese Kirschblüte, wenn sie denn mal ein paar Tage blüht. Die Natur nimmt sie eines Tages vielleicht härter ran, als diese Bütendekoration für acht Tage. Vielleicht wuchert sie und überwuchert alles? Schön eingerahmt zwischen Grün und Rosarot. An sich aber potthässlich. Plump und viel zu hoch. Und schwerfällig. Die streben überhaupt nicht den Himmel hinauf. Wie es ein richtiges Hochhaus tun sollte."
"Du kannst dich zu den fünf Stockwerken hohen Bauten stellen, wie du willst. Wir haben aus der mittleren Phase in den 70er Jahren gelernt. Wir hatten uns was dabei gedacht. Es ging um den umbauten Raum. Davon will jeder Bauherr so viel wie möglich. Wir haben den Zentralbereich gestaltet, nach bestem Wissen und Gewissen der Zeit. Die Gebäude haben wir eingebettet zwischen den Kirschblütenweg und den Botanischen Garten. Im Frühjahr, in den Tagen ihrer Blüte, wandern alle Japaner zu diesem schönsten Laubengang der Stadt. Die Kronen der Kirschbäume berühren einander und bilden ein Dach. Wenn die ersten Blüten fallen, bedeckt ein Blütenteppich den Boden auf einer Länge eines Fußballfelds. Da möchte man nicht den Fuß drauf setzen und macht einen Umweg. Natürlich nehmen die Radfahrer darauf keine Rücksicht und brettern drüber.
Vielleicht trifft das Wort flankieren nicht die Sache. Aber es verhält sich so, wenn ich auf der Plaza stehe und von der Stirnseite aus den ZB betrachte, also die Gebäude 04, 05, 06, 07 und 08, der Reihe nach, von Süden nach Norden, dann sehe ich vor meinem inneren Auge rechts den blühenden Kirschblütenweg und links, von der Mensa verdeckt, den Botanischen Garten.
Eine einleuchtendere Systematik gibt es offensichtlich nicht. Das liegt auf der Hand.
Dem Zentralbereich ist die 300 zugeordnet. Den Kliniken die 400. Nur durch den schmalen, nicht öffentlichen Weg zur Anlieferung an der Rückseite der Mensa getrennt, stoßen Klinikum und ZB aneinander. Über einen langen, gläsernen Steg sind die Bereiche in luftiger Höhe miteinander verbunden. Und zwar vom Gebäude der Humangenetik INF 366 zur Inneren Medizinischen INF410. Die wiederum ist doppelt, über- und unterirdisch, mit ihrer Schwester Kopfklinik verbunden.
Im Zentralbereich müssen Professoren und Studenten sich erstmal zurechtfinden lernen. Für die Erstsemester veranstaltet darum die Universität zum Semesterbeginn eine Stadt-Rallye. Deren schwierigste Aufgaben liegen im INF. Dann stehen höhere Semester in gelben Warnwesten an den kritischen Knotenpunkten und geben Hinweise. Zum Sommersemester sind die Warnwesten grün.
Tiefer in die einzelnen Gebäude will ich nicht eindringen. Nicht jede Wissenschaft hat ein Gebäude ganz für sich allein. Wie etwa INF326 der Physiologie und die INF328 der Biochemie. Die Anatomie teilt sich INF307 mit der Zellbiologie. Mit der Anatomie fängt ja die Medizin erst richtig an. Die Pharmazie teilt sich INF364 mit der Molekularbiologie. Wie Kraut und Rüben. Ursprünglich wollte jede Wissenschaft ihr eigenes Gebäude bekommen. Dann wurden die Planstellen weggekürzt und ganze Stockwerke standen leer. Dann sind andere eingezogen. Oder neue Wissenschaften wurden erfunden wie die Mathematische Biologie.
Der Kern des Zentralbereichs ist das in der Mitte liegende Gebäude INF346. Von diesem Zentrum aus wird der ganze Komplex verwaltet. Eins hätte ich übersehen. Auch die Biologie hat INF306 ganz für sich allein."
"Da hat sich einer einen abgebrochen." Unterbreche ich ihn.
Eugen braucht dringend eine Atempause.
"Gibt es nicht eine natürliche Ordnung für die Institute? Nach Fächern gruppiert, wie in der Schule. Vernünftig nebeneinander gebaut. Oder ist das naiv? Physik, Chemie, Mathe, Biologie? Wie die Schulfächer. Die Schulen sind ja auch so sortiert. Zumindest nach Zügen. Altsprachlich, Neusprachlich, mathematisch-naturwissenschaftlich. Auch ein Physiker soll Latein lernen können. Aber Griechisch braucht er nicht."
"Ein philosophischer Kopf muss auch rechnen können!"
"Ein Mediziner braucht heute mehr Englisch als Latein! Ein Historiker auch."
"Haben wir doch so geregelt. Dass Natur und Medizin raus kommen aus der Stadt. Nur die Kopfwissenschaften sind drin geblieben."
"Die Sozialwissenschaften sind dann unterwegs verloren gegangen?"
"Auf halbem Weg stecken geblieben." Eugen hält mich am Ärmel fest.
"Wir sind nun mal hier draußen."
Dann gehen wir einige Male still nebeneinander ̧ hin und wieder her. Wieder und wieder.
"Das INF." Sagt er.
"Das sind unsere Felder."
Er zögert.
"Wenn man es recht bedenkt."
Er stuckert.
"Eigentlich."
Ich helfe ihm nicht. Wir drehen wieder um und schauen das Neue Theoretikum hinauf.
"Zugegeben. Einen Fehler hat der ZB. Die offene, leichte Architektur."
"Offen? Dieses Betonmonster! Hol mich der Teufel!"
"Die Außenseiten sind viel zu offen. Die Balkone und Umläufe sind vom Brandschutz zur Evakuierung vorgeschrieben. Nicht zum Luftschnappen gedacht."
"All der Beton, wuchtig, schwer, doch nicht luftig leicht."
"Es sind aber Geländer für die umlaufenden Balkone. Die Fassade ist den Pflanzen abgekuckt. So, in der Art, wie eine Pflanze atmet. Sie atmen über Poren auf den Blättern. Sie ernährt sich nicht nur durch die Wurzeln. Die Pflanzen nehmen mehr O2 auf und dunsten mehr Wasser aus. Darum vergrößern sie ihre Oberfläche mit Blättern.
Bei einem Gebäude ist die Vergrößerung der Oberfläche ein Desaster. Eine Außenwand muss glatt sein. Spiegelglatt! Dann perlt alles ab. Aber diese Bauweise mit einer segmentierten Außenoberfläche offen Wasser, Wind, Hitze, Kälte, Frost ausgesetzt. Die nagen, wirbeln, beißen. Im Sommer schwitzen nicht nur die Menschen. Auch das Haus. Von wegen Frischluft und Temperaturausgleich! Der komplette Zentral-Bereich ist ein einziger Windfang. Da verfängt sich der Wind. Die Windstöße reißen und zerren, was das Zeug hält. Nach zehn Jahren haben die Reparaturen angefangen. Zwanzig solche Riesen.
"Wenn ein Haus gebaut ist, fängt es an zu kosten!"
Die Gebäude sind miteinander verbunden. Mit überdachten Durchgängen. Wir heißen sie Arkaden und Laubengänge. Nach der italienischen Architektur. Du kannst bei Regen ohne Schirm und Mantel trocken von einem zum andern deine Unterlagen tragen. Quer durch von einer Ecke in die andere. Von 324 nach 368."
Wir entfernen uns noch ein paar Schritte von diesen Baumonstern auf Stelzen. Ich gehe rückwärts und erwarte instinktiv, dass die Riesen mit jedem Schritt kleiner werden. Wie man aus den Alpen hinaus fährt und gelegentlich in den Rückspiegel schaut. Sie bleiben Betonmonster. Trotz Kletterpflanzen. Armselige Pflanzenfetzen, die vertrocknet am Beton herunterhängen.
"Pass auf, wo du hintrittst! Kuck vor dich!"
Wir kehren um.
Eugen zeigt die steilen hohen Bauten hoch und runter und links und rechts. Das steht dem Mönchweg im Wege!
"Das ist der Zentralbereich, ZB."
"Sollte eigentlich in der Mitte liegen."
"Klingt danach." Ich stimme ihm zu.
"Der ZB war zuerst. Nur, dass der Klinik-Ring nicht drum herum gelegt worden ist. Der Einfachheit halber nur daneben."
"Immerhin, auf INF300 folgt INF400 – mathematisch ganz in Ordnung. Festung ist der ZB so oder so. Noch eine Stadtmauer von Kliniken drum rum, gehopst wie gedopst."
"Von der Architektur sind der Ring und der ZB ganz verschieden."
"Dann habt ihr wohl was dazugelernt." Sage ich. "Wegen den Poren und Balkonen." Wir müssen beide lachen.
"Lass uns umkehren. Gehen wir zurück zum Bus."
"Wenn es dir pressiert! Schau dir nochmal alles gut an. Wer weiß, was nächstes Jahr ist. Und merk dir, was ich gesagt hab!"
Zurück gehen wir an der Mensa vorüber, den Teich mit hohen, halb vertrockneten Schilfstauden entlang. Das Wasser ist abgelassen. Auf dem grauen Betonboden liegen Abfälle, Müll, zerbrochene Stühle und Tische mit fehlenden Beinen. Auf den betonierten Teichrändern habe ich noch nie jemanden sitzen sehen. Ein seltsamer Uferstreifen. Schilf, das aus Beton wächst.
Wir gehen zum Eingang INF304 und dann außen die Mensa entlang. Unter dem vorgebauten Oberstock stehen Fahrräder. Ein Penner hat sich dort eingewöhnt. Sack und Pack dem Drahtesel aufgebunden.
"Student sucht Zimmer." Der Slogan des Studierenden-Werks zu jedem Semesterbeginn fällt mir ein.
"Damit habe ich nichts zu tun. Nicht Sache vom Bauamt."
All sein Hab und Gut auf zwei Rädern. Schaue mich um. Kann ihn nirgends entdecken. Das Rad steht stabil aufgebockt. Nicht abgeschlossen. Aber sicher vor Diebstahl. Viel zu schwer. Er muss Bärenkräfte haben. Fahren erscheint unmöglich mit dem Monstrum. Wird es wohl schieben.
Wir gehen die paar Stufen zum Biergarten vorm Café Botanik hinunter. Eugen geht vorsichtig, eine Stufe, dann holt er das zurück gebliebene Bein nach. Dann wieder eine Stufe. Ich bleibe stehen. Als er meinen Blick auf sein Bein bemerkt, meint er: "Das gibt sich wieder!"
Die blanken Tische und Bänke der Bierwirtschaft sind leer. Dazwischen frisch gesetzte Platanen mit einem Schutzgitter um die Stämme, wie vorn auf der Plaza, etwas klein geraten. Die Kronen flach geschnitten. Wenn die Sonne hoch steht, werfen sie sich selbst Schatten. Wir gehen stracks vorüber.
"Nehmen wir den Botanischen Garten?"
"Solange wir ihn noch haben."
Ich öffne das niedere Gartentürchen aus Aluminium, das automatisch hinter uns zuschlägt. Keine Hunde, keine Radfahrer, keine Pflanzen schneiden. Und andere Verhaltensanweisungen für die Besucher. Die Bänke um den Teich in der Mitte des Lehrgartens sind besetzt von Rauchern. Der Garten hat ihnen kleine Blumentöpfe aus Ton gefüllt mit Sand als Ascher an die Seiten gestellt.
"Das hat es früher nicht gegeben.".
"Hat man damals nicht geraucht?"
"Das meine ich nicht. Aluminium. So ist es keine Gartentür. Eine Gartentür ist aus Holz!"
Zuerst kommen wir durch den Schul- und Lehrgarten.
"Ist was für Kinder, wo keine Oma da ist mit Garten und Gemüse. Das Kroppzeug muss ich mir nicht ansehen. Ein komplettes Drittel haben wir ihm weggenommen. Heute stehen Gebäude an seiner Stelle."
Selbstbewusst und mit Stolz sagt er es. Eugen deutet nach rechts. Über den Hecken sehe ich die Balkone des Zentralbereichs, INF364, Pharmazie.
Wir gehen langsam weiter. Aus dem Lehrgarten mit seinen neuen quadratischen Beeten heraus wechseln wir in den Teil einer Parklandschaft im Englischen Stil. Das letzte Stück gehen wir auf weich federndem Boden in der Senke durch die Farne.
"Wollen wir noch schnell rauf ins Alpinum?"
"Meinetwegen nicht. Wenn du aber willst."
"Ich habe es oft besucht mit den Kindern."
"Ich mache mir nichts aus der Miniatur-Schweizer, von wegen Alpen."
"Die Kinder lieben es. Für sie ist ein Abenteuerspielplatz. Für mich eine Idylle. Mit Erinnerungen."
Zwischen Bambuswand und Alpinum verlassen wir den Garten.
Wir stehen wieder auf dem Vorplatz der Inneren Medizin. Patienten in Bademantel und Schlappen stehen vor dem Eingang und rauchen. Ein paar rollen den Ständer mit den Infusionen neben sich her. Eugen blickt zum Garten hin. Dann dreht er sich gegen die Innere Medizinische. Und wieder gegen den Garten.
"Ist doch verrückt. Weißt du, wo der Botanische Garten war, bevor er hier heraus komplimentiert wurde? Weißt du natürlich nicht! Ich will es dir sagen. Lustig ist es schon. Zum Schreien komisch. Du weißt, wo die alte Innere Medizinische war?"
"In der Vorstadt. Glaube ich. Ist da nicht Onkel Robert drin gestorben?"
Nur das Alpinum wurde dort gelassen. Nach hinten raus, an der Ecke. Alte Kliniken hatten immer einen großen Garten und Park. Alle anderen Sammlungen sind mit herausgezogen. Nur das Alpinum nicht. Solange die Alte Medizinische dort war. Beim Umbau der alten Klinik zur Bibliothek und für die Politikwissenschaft war das Alpinum Lagerplatz für den Bauschutt. Da ist es kaputt gegangen."
Dann macht Eugen eine Pause.
"Ist das nicht verrückt! Die Innere Medizinische vertreibt den Garten aus der Stadt auf die Felder. Und dann folgt sie ihm nach und schnappt sich ihn nochmal. Wo wir gegangen sind, war einmal Garten."
"Der Abschuss vom Botanischen Garten ist nicht gerade geschnitten. Nicht im Winkel."
"Hab ich dir doch schon erklärt! Hat nichts mit der Klinik zu tun. Da waren einmal Schienen gelegen. Vom Steinbruch drüben am Berg bis herunter zum Fluss."
"Aber der Bambus ist neu. Keine zwanzig Jahre alt. Das sehe sogar ich."
"Für die Feuerwehr. Von der Länge wurden ein paar Meter abgeschnitten. Genau dem ursprünglichen Bogen nach. Vielleicht noch ein wenig schräger. An der Trasse für den Gütertransport war Schluss. Die Güterlinie war noch nach dem Krieg in Gebrauch. Sie hätte gleich zu Anfang verschwinden müssen. Oder die Züge wären durch den Botanischen Garten gefahren. Vielleicht fehlt wirklich noch ein Stück. Die Feuerwehr braucht mehr Platz, dass sie im Ernstfall mit ihrem schweren Gerät nah genug ranfahren kann."
An der Haltestelle springt Onkel Eugen nochmal auf den Prellstein.
"Ist der Brocken auch vom Steinbruch?"
"Vielleicht. Von dort kam nur der Schotter für den Straßen- und Schienenbau. Denke nicht, so große Brocken."
"Vielleicht ist er doch ein Denkmal."
"Wenn du es so willst? Die Tiergartenstraße heißt ab hier Hofmeisterstraße. Hofmeister war der größte Botaniker. Ein volles Drittel von seiner Fläche hat er sich amputieren lassen müssen. Wir müssen mal ins Archiv. Seine Adresse ist jetzt INF360. Und nicht mehr Hofmeisterstraße 2."
"Ein Drittel von einem Fußballfeld? Das wäre eine Hälfte bis nah an den Mittelkreis. Der Länge nach ist es fast ein halber Kickplatz breit. Wundert mich. Dass der Garten im 300er INF Bereich liegt?"
"Wurde dem Zentralbereich zugeschlagen. Der Botanische Garten hat als Hilfswissenschaft der Heilkunde angefangen. Mit Heilkräutern und anderem Kraut."
"Historisch ist das schon immer so gewesen."
Mehr fällt mir Dümmeres dazu nicht ein. Bereue es schon, bevor es aus dem Munde ist. Warum muss ich ihm die Freude nehmen! Onkel Eugen mag nun mal die Geschichtsstunden. Auf seine Weise ist er vom Fach.
"Hofmeisterstraße. Aber links und rechts haben die Gebäude INF-Adressen. Und nicht Hofmeisterstraße."
"Immerhin heißt die Straße nicht einfach Im Neuen Feld." Damit habe ich das letzte Wort.
Von seinem Prellstein herunter zeigte er mir das erste Mal sein Navisystem. Er streckte seinen rechten Arm gerade aus und bog den linken, dass die Fingerspitzen der linken Hand das Gelenk der rechten berührten.Kapitel 4: Rundfahrt 2Die Schranke geht hoch. Mein Bus fährt weiter. Eine Stunde lang war ich mit Eugen dem Botanischen Garten auf der Spur. Das war vor fünf Jahren. Bin noch nicht so ganz bei mir. Ich denke an Onkel Eugens Worte. Die Pflanze, das Tier, der Mensch. Pflanzengarten, Tiergarten, Menschengarten. Ich muss meine Rundfahrt durch die Felder alleine zu Ende bringen. Kein Fahrgast merkt mir etwas an. Auch der Busfahrer ahnt nichts.
Der macht langsam. Um Erschütterungen der empfindlichen Instrumente in den Instituten zu vermeiden, fährt er Schritttempo. Zweimal schlägt die Straße einen Haken, damit die Enden zusammenpassen. Auch da muss er vorsichtig und behutsam einlenken. Die Hofmeisterstraße heißt nach dem ersten Haken Kirchnerstraße. Und nach dem zweiten Haken ist sie die Jahnstraße.
Ich schaue aus dem Fenster. Das meiste nehme ich nicht wahr. Als warte ich auf Eugens Stimme, die nicht kommt. Lese flüchtig die Hausnummern, die gigantisch groß den Mauern auf die Stirn gemalt sind. 371, 280, 224. Zuletzt die 100. Das Bauamt der Universität. Im System der großen Zahlen ist 100 die reale Hausnummer 1. Dort hat Onkel Eugen sein Leben verbracht. Gegenüber das erste Klinikum. Die klinische Erstbebauung. Die Alte Chirurgie firmiert unter INF110. Obwohl die Kirschnerstraße direkt vor der Haustür vorbeiführt und die Jahnstraße schnurgerade auf den Nebeneingang zu.
Zwischen Anfang und Ende der Rundfahrt, von Jahnstraße zur INF-Straße, verläuft in sportplatzbreitem Abstand zur Berliner ein schmaler, übersehener Seitenweg, vom Bauamt bis hoch zum Mathematikon, wo sie in unsere Einfahrt ins INF mündet. Diese unscheinbare Parallelstraße führt zu den Parkplätzen der entlang der Berliner. Und die LKW der Lieferanten fahren über sie an die Rampen von Rewe, Aldi und Rossmann. Wer diese Nebenstrecke einmal entdeckt hat, nutzt sie als Schleichweg. Auf den neusten Plänen ist sie als Campus-Boulevard verzeichnet.
Ich verlasse meinen Bus an der Haltestelle Alte Chirurgie. Der 32er aus der Altstadt via Hauptbahnhof hält auf der andern Straßenseite. Was dem 31er die Kopfklinik, ist dem 32er die Alte Chirurgie. Der Busfahrer hat eine Minute Zeit, um sein Fahrzeug auf 31 umzustellen. Er fährt im Uhrzeigersinn durch das INF, wir sind gegen den Uhrzeigersinn unterwegs. Die letzten Meter und wir werden aus dem INF hinaus sein. Nach Onkel Eugens physischem Navi sitzen wir oberhalb vom Bizeps. Fast schon auf der linken Schulter.
Ich hätte eine Haltestelle weiterfahren können. Aber den zweiten Haken gehe ich besser zu Fuß. Für das kurze Endstück der langen Tiergarten-Hofmeister-Kirschner-INF-Jahn-Straße will ich mir Zeit nehmen.
Am Eck INF-Jahn-Straße bleibe ich stehen. Nachdem der 31er und der 32er losgefahren und ihre Motoren verklungen sind, kann ich schon den Verkehr auf der Berliner hören. In der Jahnstraße stehe ich vor dem Max-Planck-Institut für Medizinische Forschung.
Ich wundere mich über einen Klinkerbau mit Flachdach. Er erinnert mich an die Bauhaus-Architektur. Ungewöhnlich durch die Verwendung von rotbraunem Klinker. Dieser teure Backstein als Mauerwerk findet sich vorwiegend in Norddeutschland, kombiniert mit Fachwerk und spitzem Reetdach.
Das 1928 errichtete Institut für Medizinische Forschung der Max-Planck-Gesellschaft ist das erste Gebäude der Wissenschaft auf den Feldern von Neudorf. Der Startschuss im Neuen Feld. Das MPI hat noch die Anschrift Jahnstraße 29. Es konnte seine Adresse behaupten, denn es ist von der Universität und dem Bundesland, das diese Hochschule finanziert, unabhängig. Das Institut befindet sich an der Einmündung der Jahnstraße in die Berliner Straße. Statt Jahnstraße 29 könnte es ebenso Berliner Straße 1 heißen.
Jahnstraße macht Sinn, seit ich weiß, dass dieses Institut auf dem früheren Spielfeld der TSG 1878 errichtet wurde. Ob das MPI für Medizinische Forschung aus Sportsgeist und zum Andenken an den Sportverein die Anschrift beibehalten hat, weiß nicht mal Onkel Eugen zu sagen. Das MPI hat sich auf jeden Fall bis heute nicht ins INF-Schema einfügen lassen.
Das ehemalige Sportfeld TSG 1878 ist eine Schenkung der Stadt an das MPI. Onkel Eugen besitzt die Urkunde in Faksimile. Den Grundbuchauszug hat er in Kopie.
Der Baugrund Jahnstraße 29 liegt im Gewann Unterer Kies. Das Gewann Unterer Kies besteht aus den Grundstücken Nummer 6047/1-2. Die bewirtschaftete der Landwirt Friedrich Heuser. Dem Rentner Alfred Bassermann gehörte das Nachbargrundstück 6047/3. Er war ein Sportsfreund und vermachte der 1878 gegründeten Turn- und Sportgemeinde sein Flurstück 6047/3.
Der Bauer Heuser verkaufte an die Stadt. Die Stadt genehmigte die Umwidmung der bäuerlichen Äcker zu einem Sportfeld für Ballspiele mit einer Laufbahn für Leichtathletik samt Sandgruben für Weit- und Hochsprung. Als die Stadt dem MPI das Gelände zum Geschenk gemacht hat, wurde die TSG 1878 in die Tiergartenstraße 9-11 umgesetzt, neben die beiden Rugby-Clubs TSV und SCN. Es gäbe noch so viel mehr davon zu erzählen. Auf Onkel Eugens Orientierungshilfe durchs INF bin ich von der rechten Schulter über die ausgestreckten Arme auf der linken Schulter angekommen. Und habe Form und Umfang des Campus INF klar vor Augen.
Eins will ich noch nachtragen.
Die Kliniken im Ring sind durch ein sechs Kilometer langes, unterirdisches Gangsystem verbunden. Diese Vernetzung ermöglicht eine Hochleistungsmedizin der kurzen Wege, von der Patienten, Mitarbeiter und Studierende profitieren.
Bauherr der Chirurgischen Klinik ist das Bundesland vertreten durch das Finanzministerium, vertreten durch das Amt für Vermögen und Bauwesen. Das gilt für alle Kliniken im Ring und trifft für alle Einrichtungen der Universität zu. Nichts gehört der Stadt. Die steuert nur ihren Namen bei.
Der Gebäudeentwurf für die Neue Chirurgie, die den Schlussstein und das letzte Glied in der Kette bildet, ist aus einem internationalen Architektenwettbewerb hervorgegangen. Ausführungsplanung und Baudurchführung liegen bei einem Architekturbüro in der Landeshauptstadt. Die Baufirmen und Innenausstatter der Kliniken kommen aus der ganzen Welt. Das MPI für Medizinische Forschung haben noch das Baugeschäft Zimmermann und Metallbau Ruppert errichtet.
Klinikum und Medizinische Fakultät beschäftigen rund 12 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich in höchstem Maße für die Ausbildung und Qualifizierung engagieren. In mehr als 50 klinischen Fachabteilungen mit rund 2000 Betten werden jährlich rund 66 000 Patienten voll- oder teilstationär betreut, gepflegt, geheilt. Darüber hinaus werden mehr als eine Million Patienten ambulant behandelt.
Die Zahlen und ihre Formulierung habe ich natürlich von Onkel Eugen. Er selber, denke ich, hat sie aus einer Festschrift. Aber die hat er mir nicht zu meinen Unterlagen gegeben. Manches habe ich inzwischen fest im Gedächtnis.
Ich musste das alles so penibel auflisten! Um deutlich werden zu lassen, dass da einer sich alle Mühe gegeben hat, den Campus der Wissenschaft INF sich derart verzwickt auszudenken, dass kein Mensch sich darin zurechtfindet. Manche Studierende verlassen den Campus und wissen nicht, wo der Botanische Garten ist.Kapitel 5: BerlinAb der Jahnstraße gemessen ist die Berliner Straße eine einen Kilometer lange Gerade. Ohne die drei zum Schutz der Fußgänger ampelgeregelten Einmündungen Jahnstraße, Mönchstraße und die Abzweigung ins INF bei der Haltestelle Techno-Park, wäre die Berliner Straße eine Autorennstrecke. Doppelt so lang wie die längste Gerade im Motodrom. Die Berliner Gerade wurde von Tempo 70 km/h auf 50 km/h reduziert. Das sorgt für einen niedrigeren Verbrauch und die Reduktion der Abgase.
Ampeln sind die Haltestellen der Autofahrer. Auf einer langen Geraden sind sie ein wahres Ärgernis. Als Kompromiss zwischen Autofahrern und Fußgängern und zu deren Schutz sind die Ampeln immer an Kreuzungen angebracht. Für die Fußgänger wäre es bequemer, die Straße da zu überqueren, wo sie ihnen in die Quere kommt. Aber sie werden gezwungen, Umwege zu den ampelgeregelten Straßenkreuzungen zu gehen.
Die schnurgerade Berliner Straße ist durchgängig zweispurig in beide Richtungen. Mit der Doppelgleisanlage der Straßenbahn auf dem Mittelstreifen samt Begleitgrün und den Rad- und Gehwegen hat sie eine durchschnittliche Breite von 37 Metern. An den Kreuzungen mit zusätzlichen Abbiegespuren erweitert sie sich auf 42 Meter. Damit ist sie fast so breit wie ein Fußballfeld.
Sobald die Berliner Straße ihren Zweck, die Besucher zu den drei Einfahrten ins INF zu bringen, erfüllt hat, kommt sie ihrer zweiten Aufgabe nach, den Verkehr nach Altdorf zu leiten. Für die Weiterfahrt nach Alt-Altdorf genügt eine einzige Spur. Sie reicht locker für das bisschen Verkehr. Die Berliner Straße. Die Berliner Straße führt nicht nach Berlin. Sie endet nach kaum zweitausend Metern in Altdorf. Etwa vier und eine halbe Stadionrunden.
An der Haltestelle Techno-Park geradeaus, statt links ab ins INF, beginnt nach hundert Metern die Berliner Straße ihren weiten Rechtsbogen, wird einspurig und führt um das Neubaugebiet von Altdorf herum.
Die Kurve entlang ist ein Erdwall aufgeworfen. Er dient als Lärmschutz der Anwohner. Im Scheitelpunkt des Bogens liegt hinter dem Wall dem Auge verborgen ein namenloser Park mit Wiesen, Gebüschen und hohen Bäumen, einer gewaltigen Trauerweide an einem Teich mit Fontäne, Fischen und Seerosen und einem Spielplatz. Über den Teich führt ein Steg. In der Morgendämmerung steht Ottokar im Schilf auf einem Bein und schnappt sich sein Frühstück. Die Kinder haben ihm diesen Namen gegeben. Es ist kein Storch, sondern ein Fischreiher. Einen Storch hießen sie Adebar.
Der Kinderspielplatz ist vielfältig ausgestattet mit Rutschröhre, oder sagt man Rohrrutsche, Schaukeln, Klettergerüsten, Sandwüsten, das komplette Equipment, dazu eine Busenlandschaft mit kleinen Wasserdüsen auf den Spitzen, aus denen sommers Wasser sprudelt. Der Park ist frei von Rauchern und freilaufenden Hunden.
Am Kurvenende rechts ab beginnt mit der Furtwänglerstraße das Musikerviertel. Furtwängler ist ein Personenname. Es handelt sich dabei ursprünglich um Ehemalige aus der Stadt Furtwangen. Der Name hat sich verselbständigt und rühmt nun den Größten aus dieser Personengruppe aus Furtwangen. Einen Musiker. Auf die Stadt bezogen hieße diese Straße Furtwangener Straße. Name und Straße würde ich getrennt zu schreiben haben.
Nach dreihundert Metern trifft die Furtwänglerstraße in Höhe des Krankenhauses Sankt Elisabeth im rechten Winkel auf eine Sackgasse, die den alten Flurnamen behalten hat, das Langgewann. Sie endet an einer Häuserreihe am Bogeninneren der Berliner Straße. Wie an der Haltestelle Techno-Park strecke ich in gleicher Weise an der Kreuzung Furtwänglerstraße und Langgewann beide Arme von mir. Den rechten geradeaus, den linken gebogen, und denke mir das Viertel eines Kuchens. Nur schaue ich nicht nach Westen, sondern nach Norden. Der linke, gekrümmte Arm ist der Berliner Bogen. Meine Brust bildet das Langgewann. Der gestreckte rechte Arm soll die Furtwängler sein.
Die Furtwängler hat zur Parkseite hin eine Doppelreihe roter Wohnblocks. Das Langgewann hat weiße. Zu jeder Wohnung gehört ein Stellplatz in einer Tiefgarage. Wir wohnen in zweiter Reihe zum Park hin gleich im ersten Doppelblock, mit den Nummern 16-18. Jeder hat einen separaten Eingang. Aber eine gemeinsame Tiefgarage. Unser Stellplatz befindet ich unter Nummer 18. Auch die fünf Häuser von Langgewann 2-10 haben ihre Stellplätze in unserer Tiefgarage.
Die Häuserreihen im Langgewann beginnen die Zählung bei Hausnummer 2 und setzen sie fort bis 14. Danach beginnen in der zweiten Reihe die Gebäude mit den Nummern 16-24. Bei den Hausnummern 26 und höher kenne ich mich nicht aus. Wir haben da weder Freunde noch Nachbarn, die wir kennen wollten.
Auf der gegenüberliegenden Seite der ungeraden Hausnummern ist es noch unübersichtlicher.
Ich gehe täglich das Langgewann entlang zur Haltestelle Techno-Park. Auf der ungeraden Seite lese ich zuerst die Nummer 1. Das Haus daneben ist Nummer 11, das nächste Haus springt über auf 15 und daneben steht Nummer 31. Das folgende ist Nummer 41 und das folgende und letzte in dieser Sackgasse hat die Hausnummer 65-67.
Unser Viertel und das INF wurden im selben Jahrzehnt gebaut. Beide unterliegen diesem Gefühl für Moderne der 70er Jahre. Vor fünfzig Jahren wollte die Stadtverwaltung unkonventionell sein. Sie hat die Straßen so kompliziert geplant und die Gebäude so unübersichtlich verteilt, dass kein Paketträger sich auf Anhieb im Viertel zurechtfindet. Wir Einwohner auch nicht. Ich kann ihm nicht weiterhelfen und muss ihn sich selbst und seinem Spürsinn überlassen.
Die Straße Langgewann misst 240 Meter. Sie ist eine verkehrsberuhigte und parkraumbewirtschaftete Sackgasse. Seit sie bewirtschaftet ist, haben wir wochentags wieder ausreichend freie Parkplätze. Echte Anlieger mieten das Langgewann für eine Jahresgebühr. Viele der Anlieger wohnen nicht hier. Sie wollen nur ihren Wagen abstellen, um zur Arbeit zu gehen. Etwa im Krankenhaus Elisabeth. Im Supermarkt. In der Apotheke. Beim Bäcker. Oder bei der Polizei. Diese Dienstleistungen sind gebündelt an der Ecke Furtwänglerstraße und Langgewann.
Die Straße Langgewann führt quasi zurück zur Berliner. Auf die würde sie treffen, wenn die lange Gerade sich biegt. Berliner und Langgewann stoßen nicht zusammen. Denn der Kollision steht im Bogeninnern eine Anzahl Reihenhäuser im Weg. Es sind, von rechts nach links, die Hausnummern 69-87. Es handelt sich um schmale Reihenhäuschen mit nur geringfügig voneinander abweichender Architektur. Sie stehen Schulter an Schulter. Vor den Häuschen sind winzige Gärtchen. Einige sind zu einem Stellplatz am Haus umgebaut. Jedem Reihenhaus ist ein Parkplatz entlang der Straße zugeordnet. Sie verbreitert sich stark, damit Besucher, die sich verfahren haben, wenden können.
Zwischen Reihenhäusern und Erdwall gegen die Berliner gibt es einen gut zehn Meter breiten Streifen für ein Gärtchen oder eine Terrasse. Rechts und links führt ein schmaler Weg für Fußgänger und Radler an den Reihenhäusern 69-87 vorbei zur Berliner Straße.
Ich nehme den linken Weg, vorbei an Nummer 87. Es ist das End- oder Eckhaus in rotem Backstein, südländischer Architektur auf einem breiteren Grundstück. Es liegt ums Eck und ist von der Straße Langgewann aus nicht zu sehen. Es ist das Haus von Onkel Eugen und Tante Nelly. Von Eugen geplant, genehmigt und gebaut.
Den Weg seitlich am Haus vorbei ist eine Heckenwand gesetzt. Die grüne Hecke ist gesprenkelt mit gelben Forsythien-Blüten. Rosenstöcke treiben rote, weiße und gelbe Blüten. Sie treiben zweimal, dreimal im Jahr. Schon Ende Februar. Noch spät im Oktober.
Und üppige Büscheln Lavendel wuchern für die Bienen auf dem Mäuerchen. An der Südseite des Hauses ist Platz für eine Pergola mit Weintrauben, an Kreuzgittern hochgezogen, vorm großen Fenster steht ein Feigenbaum, wie er in Italien nicht fruchtbarer gedeiht. Alles in lässlichem Langwuchsschnitt. Südseite pur. Ein üppiges Paradies auf kleinstem Raum. Das hat die Bewohner die Garage gekostet. Der 635csi steht in unserer Tiefgarage. Den Stellplatz sind wir Onkel Eugen und Tante Nelly schuldig. Als sie jung waren, fuhren sie jeden Sommer nach Italien. Über den Brenner. Über den Gotthard. Wie sie Lust hatten. Ein gerüttelt Maß an Angeberei war auch dabei. Zuerst an die Adria. Später in einen der Orte der Cinque Terre. Die haben sie der Reihe nach abgeklappert. Mobilsüchtige. Die letzten Sommer war ihnen Italien zu anstrengend. Zu alt. Sagte Eugen. Alt auch der BMW. Seitdem fuhren Eugen und Nelly sommers in dem mit ihnen alt gewordenen 635csi in die Schweiz. Ins Bündner Land. Den Rest des Jahres bleibt er in der Garage. Sie erledigen alles zu Fuß.
Gemeinsam machen sie sich auf den Weg zur Arbeit. Er begleitet sie. Sie begleitet ihn. Onkel Eugen führt sein Fahrrad nebenher. Er geht ins Bauamt INF100. Nelly ins Zentral-Labor der Kliniken INF400. Eine Leitende Oberärztin und Chefin der Labormedizin und ein Abteilungsleiter.
Sie wandern gewissermaßen Hand in Hand jeden Morgen bis zu jener, durch eine komplizierte Ampelanlage geregelten, Fußgängerüberquerung der 45 Meter breiten Berliner Straße. Dort stehen sie dann und warten. Bevor die Ampel ihnen grün gibt, einen letzten Kuss. Schon sitzt Eugen im Sattel und radelt los. In einem langen Schwung über die Berliner; zwei Fahrbahnen von links, in der Mitte die Gleisanlage, zwei Spuren von rechts. Tausend Mal perfekt getimet. Er kommt drüben an, auf die Sekunde genau, fädelt sich ein, die Berliner haben grün. Ein letztes Winken. Eugen nimmt Tempo auf für die lange Gerade der Berliner. Bis zur Jahnstraße wird Tempo bolzen. So hält er sich fit.
Nelly hat es gerade bis zur Mitte geschafft. Weiter will sie nicht. Sie wartet freiwillig und winkt. Schon hat sie ihr Handy in der Hand. Sobald die Abbieger ins Neue Feld anhalten, die Berliner wieder fahren dürfen, und Eugen verschwunden ist, geht auch sie los. Mitten auf der Gleisanlage durchquert sie die Abbiegung ins INF. Alles tausend Mal auf die Sekunde erprobt. An der Haltestelle stadteinwärts springt sie in eine Autolücke und huschhusch über die halbe Berliner. Vorbei am Eingang Nord des Mathematikons geht sie Campus einwärts. Alles sehr gemütlich. Sie hat es niemals so eilig wie Eugen. Bei den Geologen weicht sie von der INF-Straße links ab, am Teich unter dem hohen alten Baumbestand vorbei, kennt sie mit geschlossenen Augen die Richtung, immer geradeaus hinter den Instituten vorbei. Den Autoverkehr hat sie schon vergessen. Sie hört nicht die Autos, und sieht sie nicht hinter den Hecken. Es ist ihr egal, ob Stop oder Go.
Jeden Morgen macht Nelly ihren Spaziergang durch die Grünanlagen des Campus. Passiert das Rechenzentrum, überquert die Wiese mit den Birn- und Apfelbäumen, die von früher stehen geblieben sind. Manchmal telefoniert sie. Sie pfeift fröhlich. Nelly genießt den Morgen. Bei den Verzweigungen muss sie sich immer links halten. Das wissen ihre Füße.
Nicht die Gerade gilt hier als kürzeste Verbindung. Sie folgt willig den Wegen, die die Campus-Planer sich durch den Campus haben einfallen lassen. Andere Fußgänger auf dem Weg zur Arbeit kürzen ab über das Gras. Das letzte Stück dann schnurgeradeaus. Es sind die schönsten hundert Meter. Sie geht den Japanischen-Kirschblüten-Weg stracks auf die Patienten-Liegend-Anlieferung der Kopfklinik zu. Im Souterrain hat sie ihr Labor. In der Baumblüte schneidet sie sich ein Zweigchen herunter und stellt es in eins ihrer Gefäße. Wenn die Kirschen rosa blühen, geht sie auch am Wochenende ins Labor. Um keinen Tag diesen Laubengang zu versäumen. Jeden Morgen geht sie so. Auch sonn- und feiertags, wenn es denn sein muss. Herrin ihrer Zeit, muss sie sich nie beeilen.
Bis vor zwei Jahren ein später Biker von der Berliner noch ins INF abbiegt. In letzter Sekunde oder danach. Ihr den Weg abschneidet. Es gibt eine Aufnahme von weit oben. Aber keine Blitzanlage hat dokumentiert, wer grün, wer rot hatte. Eine Gelbphase beantwortet die Schuldfrage nicht. Es hätte sie auch nicht wieder lebendig gemacht. Die Schuld teilten sich Nelly und der Biker. Eugen befand sich noch in Höhe Mathematikon. Da war sie schon tot. Das Schreien der Augenzeugen hat Eugen anhalten lassen. Die das Unglück mitansehen mussten, haben auf Nelly gezeigt, die auf der Fahrbahn lag. Eine Augenzeugin wurde mit Schock in die Innere Medizinische gebracht. Der Biker ist in Nelly reingeknallt und hat sie übern Haufen gefahren. Das Motorrad war gegen das Gebäude geprallt. Dem Biker ist nichts weiter passiert. Ein Glück, dass all das wenige Minuten von den Kliniken entfernt passiert ist. Nelly hat noch ein zwei Tage im Koma gelegen. Tante Nelly liegt drei Minuten Fußweg von daheim auf dem Neudorfer Friedhof begraben. Zu ihrem Begräbnis ist er nicht gegangen.Kapitel 6: KlopferVon da an sitzt Onkel Eugen in seiner Haltestelle am oberen Ende des Mathematikons. Früh verlässt er das Haus, sitzt an der Haltestelle und gibt Auskunft. Ein hilfsbereiter Mensch, denkt jeder. Ein wenig seltsam. Aber nicht bösartig. Die halbe Zeit, als würde er schlafen.
Erscheint jemand auf wackeligen Beinen, wacht Eugen auf. Er rückt beiseite, klopft einmal, zweimal, dreimal mit der flachen Hand neben sich auf das frei gewordene Plätzchen, und viermal, so oft, bis eine reagiert, ihn anschaut und sich endlich traut. Zuletzt hat er sie an seiner Seite. Er fragt nach dem Woher und Wohin. Wohin die Linie 24 fährt, die da von rechts ankommt. Und wohin die 24 in Gegenrichtung unterwegs ist, wenn sie von links kommt. Woher und wohin die 21. Was es mit dem 31er Bus auf sich hat. Ungefragt gibt er Auskünfte. Auch hellwach bleibt der Klopfer friedlich. Keineswegs lästig oder zudringlich. Onkel Eugen ist dabei freundlich, wie wir ihn nicht anders kennen.
Bin hin- und hergerissen zwischen "Klopfer" und "Onkel". Weiß nie so recht, wie ich ihn nennen soll. Irgendwie war er als Klopfer nicht der Onkel Eugen von früher. Als Klopfer bleibt immer eine unbestimmbare Distanz. Als hielte ich ihn mir vom Leib. Sagt man doch so. Vom Leib halten, nicht von der Seele. Wir laufen nun mal einander täglich über den Weg, auch wenn er seit Nellys Unfalltod nicht mehr ins Amt geht. Auch das hatte ein anderer für ihn regeln müssen, dass er seine Altersbezüge erhält.
Auch mir hat er ein Plätzchen angeboten. Vielleicht treibt er nur sein Spielchen mit mir, dachte ich. Er befand sich noch immer in einer schlechten Verfassung. Onkel Eugen erkannte mich nicht. Ich war ihm einen Fremder und hielt meinen Mund.
Als er mir er in seiner Haltestelle ein Plätzchen an seiner Seite freigeklopft hat, trug ich eine Manschette am linken Fuß und eine Krücke in der Hand.
"Die Orthopädische ist aber nicht da!" Sagte er und zeigte Richtung INF. "Da sind Sie ganz verkehrt!" Sagte er mit Nachdruck und zeigte mit der Linke über die Schulter in die andere Richtung. "Die 21 können Sie nehmen. Aber umsteigen müssen Sie in den 35er." Setzte er nach und hat auf meinen Fuß gedeutet. Er hat mir alle möglichen Verbindungen aufgezählt, die mich in die Orthopädische bringen würden.
Ich habe ihm gesagt, dass ich nicht auf dem Weg zum Arzt sei. Nur drei Haltestellen weiter zu meiner Arbeit wolle. Und dass ich mit dem Fuß weder zu Fuß noch mit dem Rad ins Kolleg komme wie sonst. Die Haltestelle "Studierendenwohnheime mit Zugang zum NCT" müsste ich schon wieder aussteigen.
Bereitwillig rückt er auf dem kurzen Bänkchen ein kleines Stück beiseite und macht das halbe Plätzchen neben sich frei. Nickt freundlich und klopft einladend auf die drei Brettchen.
"Möchten Sie sich nicht setzen?"
"Wann kommt der 31?" Es war nur mein Versuch einer Konversation.
"Muss gleich kommen!" Eugen streckt seinen Arm zur elektronischen Anzeige hinauf.
"Wohin wollen Sie?"
"Danke schön. Wohnheime. Und Sie?"
Als hätte ich mich nochmal zu erklären, warum, woher, wohin und wozu ich hier stehe. Vielleicht Lust auf eine neue Runde Kennenlernen. Oder er hat einfach nicht zugehört.
"Sie können auch den Bus 37 nehmen, kommt drauf an, wohin Sie wollen. Dann begleite ich Sie ein Stück. Ich kenne mich aus wie in meiner Westentasche. Ich habe das alles gebaut. Ich kann ihnen alles zeigen."
"Ich weiß!"
"Ich habe jede Hausnummer im Kopf." Sagt der Klopfer. Er lacht laut und ungeniert. Die Leute drehen sich nach uns um.
"Ein Verrückter", flüstert eine Mitfahrerin mir ins Ohr. "Passen Sie auf! Der will nur kostenlos mitgenommen werden! Mit Verrückten ist nicht gut Kirschen essen."
Er ist dann mit eingestiegen. "Ich begleite dich." Mit dem Du war das Eis gebrochen. Er ist mitgefahren. Der Bus war voller Studierender. Er hat dem Fahrer Bescheid gegeben, dass ich was Zeit brauchen würde, um auszusteigen. An der Haltestelle hat er die Studierenden an mir vorbei gewinkt. Ich konnte als Letzter ungehindert den Bus in aller Seelenruhe verlassen.
Seinem Wesen nach war Onkel Eugen sein Leben lang ein ausgeschlafenes Kerlchen! Klein, drahtig, fix auf den Füßen, aber über Schuhgröße 39 ist er nicht hinausgewachsen. Kein Fitzelchen Fett auf den Rippen. Ein Meter und siebzig. Und 55 Kilo Lebendgewicht. Schlachtreif? Weit entfernt vom Schlachten. Kahl, braungebrannt, ein schmales Gesicht. Dicke Lefzen machen ihm ein großes Mundwerk.
Von Fotos kenne ich ihn als jungen Mann. Er hatte sandfarbenes, seitlich gescheiteltes Haar, von Natur lockig gewellt, nach der herrschenden Mode stylisch streng und glatt über den Schädel gebürstet. Seine Augen sind grau, die unteren Lider wie mit dem Lineal eines Bauzeichners gezogen gerade. Sein Mund eine gerade und harte Linie unter einem kurzgestutzten sandfarbenen Schnurrbart. Furchen wie geschnitten fallen von seinen Nasenflügeln über die Mundwinkel herunter, wie bei einer Puppe eines Bauchredners. Es ändert nichts an seinem losen Mundwerk! Mit den Jahren sind ihm die Haare ausgegangen. Ein kleiner, schmaler Mann war er schon immer.
Soll ich die handelnden Personen wirklich so körperlich genau beschreiben? Die Farbe ihrer Haare, Augen und Häute sagen doch nichts über ihre Handlungen aus. Warum mich damit aufhalten?
Onkel Eugen ist ja nicht ein Onkel, als wäre er der Bruder von Vater oder Mutter. Durch Scheidung und Wiederheiraten kommt im Laufe der Jahre eine Menge neuer Schwäger und Schwägerinnen und Onkel und Tanten in die Familie. So einer ist Onkel Eugen.
Tante Nelly war energisch und übertüchtig. Leitende Oberärztin für Labormedizin. Ihre blonden Haare hatten ein paar Silberstreifen. Sie war neugierig. Ich weiß nicht, wo sie ihn aufgegabelt hat. INF eben.
Das Motorrad ist einfach in Tante Nelly reingeknallt.
So hat er dann jeden Morgen, früh mit dem ersten Tagwerden, an der Haltestelle gesessen. Gewartet sicher nicht. Aber ich war gespeichert in seinem Hirn. Er hat nicht weiter darüber geredet. Ist jedes Mal mit mir eingestiegen, hat den Busfahrer auf meine Behinderung aufmerksam gemacht und wo ich aussteigen würde. Wenn es der Fahrer vom Vortag war, hat er ihn nur erinnert. War es ein neuer Fahrer, hat er ihn darüber aufgeklärt, dass ich in keine Klinik will, sondern zur Arbeite fahre. Und dass ich mit dem Bein im falschen Bus stehen würde. Er hat sein Späßchen gemacht von wegen Kopfklinik mit dem Fuß. Und er mich in den richtigen gesetzt hätte, der mich in die Orthopädie bringen würde. Was aber nicht nötig wäre. Da ich mich nicht im Krankenstand befinden würde, sondern meiner Arbeit nachginge. In der zweiten Woche wusste er, dass ich nicht in der Orthopädischen der Universität in Behandlung war, sondern im katholischen Sankt Elisabeth, gleich eingangs von unserer Straße, die aber nach einem Gewann heißt, nämlich Langgewann, langes Gewann. Obwohl das Sankt Elisabeth, "Steli" sagte er kurzerhand, obwohl das Steli in der Hauptsache Kinder auf die Welt bringt und nur ein Belegkrankenhaus der Orthopädie für Sportverletzungen im Anbau des Steli ist.
Eugen kannte alle Busfahrer. Und alle Mitfahrenden auf seinem Radar. Wie man eben seine Mitfahrer wahrnimmt, die jeden Morgen zur gleichen Zeit die gleiche Strecke hinter sich bringen müssen. Meist stumm, unwirsch und feindselig. Früher, sagte später mir Eugen einmal, als wir unsere Verwandtschaft eingestanden haben, hätten die sich hinter ihrer Zeitung versteckt. Heute haben sie das Handy dafür. Und reden mit dem Handy, statt sich zu erkundigen, wie es dem Nachbar geht.
Nicht jeder kommt damit zurecht, wenn er angesprochen wird. Letztes Jahr war er ganz heiß, der Sommer, sodass Onkel Eugen alles rausgeschwitzt hat, um es los zu werden. Und schwitzte vor Eifer. Wenn ihm zu Ohren kommt, was ich über ihn verbreite, bringt er mich um – vor Stolz.
Meine Frau ist mütterlicherseits eine Bechtelin. Die Bechtel waren anfangs Bauern. Dann stiegen sie empor, wurden wohlhabend als Sau-Bechtel. Dann wurden aus den Sau-Bechtel die Bau-Bechtel. Wir Zimmermänner und -frauen sind seit Generationen im Baugeschäft und müssten eigentlich Baumann heißen. Von einem echten Zimmermann in der Familie, der seinen Beruf ausüben und seinem Namen Ehre machen würde, weiß keiner mehr was. Mal Onkel Eugen danach fragen.
Der Campus kennt keine Straßennamen. Warum das so ist? Wer sich dieses System ausgedacht hat? Ist ganz in Ordnung! Nur was versteckt. Onkel Eugen hebt den Mahnfinger. Steckt wohl auch ein Stück Lehrer in ihm drin.
"Ich habe das System Ende der 60er entwickelt." Sagte Onkel Eugen zu mir noch ganz in der Rolle als Klopfer. In einem Ton, als würde er sich stolz auf die Brust klopfen. Ein Sprücheklopfer.
"War ein junger Spund. Hatte gerade ausgelernt! War weit und breit nicht dran zu denken, dass zu meinen Lebzeiten neue Institute sich derart drum herum scharen würden."
Den Zentralbereich eine Betonwüste nennen, nimmt Eugen noch heute persönlich. Ein unfreundlicher Akt. Und macht ihn fuchsteufelswild.
"Im Zentralbereich und um den Zentralbereich herum sind die Hausnummern verstreut, wie vom Bauer der Samen ausgeworfen wird." Gebe ich im Kontra.
"Wer im INF seinen Platz finden will, muss eh‘ Studierte sein! Der muss den Weg zu seinem Institut von selber finden. Anders taugt er nicht für eine Karriere."
Pure Lust auf Widerspruch.
"An die armen Patienten denkst du gar nicht!"
"Haben eh‘ nur ihre Krankheiten im Kopf."
"Die haben immer einen bei sich."
"Einer wie du! Der sich auskennt und sich erbarmt."
"Das tu‘ ich gelegentlich." Das sagt Klopfer. Wieder ganz ruhig und bescheiden geworden.
Als die harte Schale geknackt war, hörte Onkel Eugen nicht mehr auf zu reden. Von da an hatte ich ihn für lange Zeit am Hals. Das Begräbnis, seinen Ruhestand, um alles habe ich mich gekümmert. Weniger aus Verwandtschaft. Mehr wegen unserer Nachbarschaft.
Ich habe ihm geholfen, dass er die Vergangenheit vergisst. Nelly und sein Leben mit ihr. Die Orte ihres Lebens. Sein Haus. Davon hat er sich erst gelöst, als er sich die Hübsche Heidrun beigeklopft hatte. Die Heidrun Hübsch, eine geborene Frauenfeld. Das Pendant zum Frauenfeld ist der Herrenacker. Am Ende steht der Gottesacker. Heidrun hat mir den Eugen vom Hals geschafft. Ich wünsche ihm alles Gute und dass er wieder glücklich mit ihr. Und Heidrun mit ihm. Bin sicher, das schaffen die beiden.Kapitel 7: TapetenwechselDas Dilemma bei einer Depression ist, dass einer nicht aufstehen will. Ich kann Onkel Eugen nur loben, dass er jeden Morgen aus dem Haus geht und an seiner Haltestelle Auskünfte gibt. Dann ist seine Depression vergessen. Allein dadurch, dass er aufgestanden ist. Er hätte auch im Bett liegen bleiben, ein paar Pillen schlucken und auf ihre Wirkung warten können.
Es ist mir zunehmend schwerer gefallen, mitansehen zu müssen, wie er in der Haltestelle auf seinem Arme-Sünder-Bänkchen sitzt und sich lächerlich macht. Die älteren Fahrgäste haben ihn bedauert, bemitleidet, die jüngeren verspottet. Wer den Namen "Klopfer" aufgebracht hat, habe ich nicht herausfinden können.
Ich habe ihm eine kleine Wohnung in den Roten Blocks besorgt. Zwei Minuten von uns. In der zweiten Reihe der Furtwänglerstraße. Bei der Gelegenheit hat er mir die Schaffner-Geschichte erzählt. Hat ein Theater aufgeführt, dass er auf keinen Fall auf Pfarrgrund wohnen will. Aber mit einem flinken Augenzwinkern hat er sich verraten. Bereits bei der ersten Besichtigung war er gar nicht mehr wegzukriegen vom Fenster zum Park. Der hat es ihm angetan. Seine schiere Größe. Aber sein kleiner Garten sei das wahre Paradies. Er hat hundertmal angepriesen, was ums Backsteinhaus gedeiht. Die Nüsse, Feigen, Trauben, Lavendelbüschel, Rosen, die sich durch die hohe Hecke drängen, dreimal blühen sie im Jahr und schieben ihre Blütenköpfe durchs Dickicht, erst winzig klein, dann handtellergroß und schließlich größer als seine Füße. Selbst seinen winzigen Teich hat er über den grünen Klee gelobt. Und die haushohe Fontäne, die winters im Frost zur Eisskulptur gefriert, lässt er kaum gelten gegen sein Springbrünnelchen, das in seinen beistelltischkleinen Teich tröpfelt.
"Noch nicht!" Er hat sich geziert. Sein Herz hing am Haus. Im Haus lebte er weiter mit Nelly. In lebendigen Erinnerungen.
"Dann ist die Wohnung weg!"
Ich habe ihm die Balkontür geöffnet. Habe ihn allein rausgehen lassen. Er hat die Luft des Parks geatmet und sein Grün mit weit aufgerissenen Augen verschlungen. Da war er gar nicht mehr reinzukriegen. Küche, Bad, Diele, Wohnzimmer, Schlafzimmer haben ihn nicht mehr interessiert.
"Komm!"
"Drängel nicht!"
"Morgen ist es vielleicht zu spät."
"Lass mich noch was bleiben. Kannst gehen, wenn du pressierst."
"Ich habe alle Zeit der Welt."
"Gib mir vier Wochen."
Wir sind noch was geblieben. Ich habe mich still in eine Ecke gestellt. Er ist herumgelaufen. Türen probiert, ob sie richtig schließen. Die Fenster waren ihm wichtig, wohin sie führen. Und immer wieder hinaus auf den Balkon mit Blick auf und über den Park.
Ich hatte die Wohnung längst auf meine Kappe genommen! Das brauchte er nicht zu wissen.
Ende September war Eugen so weit. Er ist innerhalb drei Tagen eingezogen. Hat nichts mitgenommen aus dem Haus. Nicht ein Möbelstück. Keine Klamotten. Nur was er anhatte. Kein Geschirr. Nichts! Nicht das kleinste Fitzelchen. Absolut nichts!
Sein schönes Klinkerhaus steht leer, voll Erinnerung an Nelly. Gelbe und rote Rosen in der grünen Hecke, Lavendelbüschel für die Bienen, ihre Weintrauben, ihr Feigenbaum mit den süßen Früchten. Es wird ein harter Kampf, dass er es verkauft.
"Schlag dir das aus dem Kopf! Nicht, bevor ich auf dem Friedhof liege."
Ein Dach überm Kopf oder im Schatten eines Baums. Wo ein Haus sich breit macht, bleibt kein Platz für einen Baum. Wir gehen, weil wir uns nicht entscheiden können, ob wir stehen oder liegen wollen.Kapitel 8: FlurnamenOb der Bauer die Felder bestellt oder der Architekt mit Gebäuden. Mich hat das Bauen immer fasziniert. Auch meine Geschwister blieben an jeder Baustelle stehen und schauten in die Grube. Wir bestaunten einen halbfertigen Rohbau mehr als die Schlossruine unserer Stadt. Wo gebaut wird, ist Geld. Immer wird irgendwo in der Stadt ein Neubau angefangen. Manchmal ist es die dritte, vierte Bebauung der einen Stelle. Die archäologischen nicht mitgerechnet, Kelten, Römer, Franken. Das Bauen hört niemals auf. Wie das Brotbacken.
"Ohne Grundstück geht gar nichts. Bauen fängt mit einem Bauplatz an. Darum sind Flurnamen eine spannende Geschichte."
Onkel Eugen hat mir den Flurplan auf Folie kopiert. Die legt er über den Lageplan des Neuen Campus.
"So machst du das! Nachher siehst du, auf welchem Acker welches Gebäude steht." Sagt Onkel Eugen.
"Folgendermaßen musst du dir das denken." Fährt Eugen dann fort. "Die Äcker, auf denen wir das INF errichtet haben, waren einmal in Gewanne zusammengefasst. Ein Gewann besteht aus vielen Äckern für die Bauern, Landwirte und Gärtner. So scheibchenweise, dass jede Familie was abbekam. Die in einem Gewann zusammengefassten Äcker gehörten den Herren des Landes (sic!), früher dem Kaiser, König, den Fürsten, heute dem Staat. Und immer waren die Kirchen mit im Spiel.
Von den 36 Gewannen von Altdorf und Neudorf hat das INF 17 geschluckt. Davon gehörten 12 Gewanne zu Neudorf. Und 5 zu Altdorf. Von denen 5 sind zwei schon bebaut. Das Gewann Bodenmeister ist komplett verbraucht mit dem Sportzentrum. Das meiste von dem Pfädeläcker Gewann hat der Tennis-Club von Neudorf! Obwohl die Pfädeläcker zur Altdorfer Gemarkung gehören.
Das Viertel, wo wir wohnen, war Ackerland im Langgewann. Darum heißt unsere Straße so. Aber das ist eher selten. Deine Schule steht auf den Maulbeeräckern. Die waren ein riesiges Gewann. Darauf standen die Maulbeerbäume für die Raupenzucht vom Kurfürst. Dein Collegium steht auf dem Galgenbuckel."
Mit jedem Namen, den er nennt, tippt er mit zwei Fingern auf die Stelle auf der Folie mit dem Namen des Gewanns. Und nochmal mit dem Zeigefinger allein, als wollte er durch die Folie stoßen, um bis zum Gebäude, Institut, zur Klinik oder Einrichtung durchzudringen.
"Der Neue Campus INF hat also bis jetzt 17 Gewanne verbraucht. Und hat noch zwei Gewanne in Reserve. Dem Land gehört das Saubad, die Universität hat schon das Baurecht auf dem Hühnerstein."
In Wirklichkeit verhält es sich andersrum, als Eugen es mir vordemonstriert. Unten liegen die Gewanne, drüber stehen die Gebäude. Nicht die Gewanne liegen auf dem Gebauten. Das verkneife ich mir. Und der knappen Zeit halber mache ich es kursorisch.
Die Altdorfer Gewanne des INF liegen alle nördlich der INF-Straße. Und, soweit sie mich interessieren, zwischen INF-Straße und Nonnenweg. Noch weiter nördlich vom Nonnenweg gibt es noch viel mehr Felder als die für den Neuen Campus bisher benötigten 17 Gewanne. Genug Platz für später.
Onkel Eugen könnte die Namen aller Gewanne komplett hersagen. Und was drauf gebaut steht. Und alles sehr viel ausführlicher, als ich es zusammenfasse. Und in seiner im Dialekt eingefärbten Sprache. So sagt Eugen immer "das Campus".
Der Botanische Garten liegt quer über den zwei Gewannen Röscher und Neusatz. In den unteren, südlichen Hälften. Das MPI in der Jahnstraße steht auf dem Schafspfad. Dieses Gewann war kein Pfad, sondern breite Weideflächen. Breit und vor Hochwassern sicher genug, um für einen Sportplatz und das Institut für Medizinische Forschung die Grundlage abzugeben.
Die drei Gebäude des Mathematikons stehen auf dem Gewann, das Viertelfeld heißt.
Der Röscher, auf dem der Botanische Garten teilweise liegt, ist ein langer Gewannstreifen in Nord-Süd-Richtung und liegt sowohl auf Altdorfer als auch Neudorfer Gemarkung. Mittendurch verläuft der Nonnenweg und teilt ihn in einen Oberen und Unteren. Der Obere ist das Altdorfer Teil. Der Untere Röscher gehört zur Flur vom Neudorf. Der Röscher zieht sich länger hin als unser Langgewann. Aber wen interessiert das? Die Gewanne verlaufen tendenziell in nord-südlicher Richtung. Demzufolge liegen die Äcker in ost-westlicher. Die Äcker sind ja die in Scheiben geschnittenen Gewanne. Wie gesagt: Wen interessiert’s?
Es würde zu weit führen, und bringt auch wenig, noch die einzelnen Felder aufzuzählen und ihre letzten Besitzer namentlich zu nennen. Die haben Eugen und ich im Archiv anhand der Flurnummern im Lagerbuch rausgefunden. Und ein paar rausgepickt. Sofern sie uns interessierten. Die Nummern sind hier auf einem anderen Flurplan verzeichnet, als dem foliierten, den wir verwenden, um die Gewanne mit ihren Gebäuden abzugleichen.
Bei den Nummern der Äcker handelt es sich um fortlaufende, überwiegend vierstellige Zahlen. Ob vier- und zweistellig, hängt davon ab, ob das Verzeichnis der Äcker von vor oder nach 1900 stammt. Jedes Dorf fängt sein Grundbuch mit der 1 an, wenn es seine Grundstücke zu zählen anfängt und auflistet. Es ist völlig egal, ob schon Häuser drauf gebaut sind wie im Ortskern, oder die Bewohner sie außerhalb als Acker und Feld oder Weideland für Kühe, Schafe oder Pferde nutzen. Für die Zählung macht das keinen Unterschied.
Altdorf hatte schon immer um die zweihundert bebaute Grundstücke. Der Rest war landwirtschaftlich genutztes Ackerland. Den zusammen rund 350 Grundstücken hat das Grundbuch von Altdorf jedem eine Nummer verpasst. Von der 1 bis zur 343. Aus 343 verwertbaren Grundstücken besteht Altdorf noch heute. Und 343-mal standen dabei die Eigentümer im Grund. Und auch, wie und wofür sie die Grundstücke genutzt haben. Da wurde für draußen in den Feldern natürlich nicht Kartoffelacker eingetragen. Der Ratsschreiber schrieb landwirtschaftlich genutzt. Aber auch landwirtschaftlich genutzt mit Schuppen. Das habe ich ein paarmal gelesen, wenn ein Geräteschuppen darauf gestanden hat. Oder innerorts heißt es Wohngebäude, Stallung, Scheune; manchmal heißt es Trockenscheune, Pferdestall, Kuhstall, Schafe, Schweine. Später kamen die Garagen und Stellplätze dazu. Das Dorf ist gewachsen.
Das Altdorfer Grundbuch wurde fortlaufend angepasst. Durch Heiraten kamen Grundstücke in andere Familien. Wurden von aus Ackerland bebaute Stücke mit neuen Häusern. Durch die Bebauung ist Altdorf gewachsen. Wenn auch im Schneckentempo. Nicht vergleichbar mit später.
Als Altdorf und sein Ableger Neudorf, das auf den Äckern von Altdorf entstanden ist, aber sehr früh, von Anfang an ein eigenes Grundbuch geführt hat, dann Stadtteil wurden, wurden alle Äcker neu durchnummeriert. Die Zahlen in den ganz frühen örtlichen Grundbüchern sind im Lauf der Jahre verloren gegangen. Wahrscheinlich durch die beiden Kriege.
Als die beiden Dörfer Stadtteile geworden sind, hat das Grundbuchamt der Stadt sie ganz praktisch an ihren Bestand angehängt und weitergezählt. So tragen die Felder, die für den Botanischen Garten abgegeben werden mussten, die stadttypisch hohen Nummern von 5909 bis 5932 im Neusatz, und 6111 bis 6155 im Röscher. Für die Grundstücke zum Bau des MPI für Medizinische Forschung an der Jahnstraße habe ich die Nummern 6047 und 6048 gefunden. Es waren bereits größere, mehrere Äcker und Weiden zusammenfassende Areale. Solche großen Gewann-Stücke kenne ich sonst nur von kirchlichem Grundbesitz. Oft und in den häufigsten Fällen besaßen die Kirchen aber ganze Gewanne komplett.
Nach der sukzessiven aber zügigen Erwerbung der Gewanne durch das Land brauchte niemand mehr die Ackernummern. Statt klein-klein genügte der Name vom Gewann als Sammelbegriff. Es sagt sich leichter, dass die Neue Chirurgie in der Langen Furche liegt. Oder dass der Klinikring in den Kirschbaumäckern beginnt und sich schließt.
Doch im Grunde breitet sich der INF-Campus über Hunderte von Äckern aus. Menschlich gesprochen: Hat es einigen hundert Feldern die Existenz gekostet. INF ist heute der gemeinsame Oberbegriff für alles Gelände zwischen Fluss und INF-Straße bzw. dem Nonnenweg.
In Onkel Eugens Vorstellung ist es der Raum vor meiner Brust zwischen dem linken und rechten Arm. Wenn ich es denn Onkel Eugen nachmache und seinem Vorschlag folgen will. Also den rechten Arm gerade und den linken krumm ausstrecke. So in etwa.
Dank Onkel Eugens Kontakten und seinen Tricks bin ich allmählich zu meinen Informationen und der richtigen Vorstellung vom INF gekommen.
Eugen hat das meiste im Kopf und könnte es auswendig hersagen. Für mich hat er Kopien besorgt. So hatten wir immer das betreffende Blatt vor Augen. Anders wären wir nicht vorangekommen. Ich hätte immer dazwischenfragen müssen. Soviel Geduld und Zeit hat Eugen dann doch nicht mehr. Mit seiner Heidrun. Vermute ich mal.Kapitel 9: KiesEntlang der Tiergartenstraße, doch außerhalb des INF liegen der Zoo, die Jugendherberge, die Rugby-Clubs, die Sportanlage der TSG 1878 und das Tiergartenschwimmbad. Sie befinden sich innerhalb der natürlichen Grenze, geschützt im Arm des Flussbogens.
Diese Anlagen und Einrichtungen für die Allgemeinheit sind auf einem einzigen Gewann errichtet. Das Kies ist vielleicht das größte Gewann. Wegen seiner Länge ist seine Größe in Quadratmetern schwer zu bestimmen. Das Kies ist das komplette rechte Ufer den ganzen Flussbogen entlang. Wegen seiner Unübersichtlichkeit unterteilt es sich in das Obere, das Mittlere oder Große, und das Untere Kies. Aufgrund der einheitlichen Qualität des Bodens sind diese drei Kiese geologisch als eine Einheit und aus einem anderen Grund als ein einziges Gewann anzusehen. Das Kies besteht aus Kiesel, Sand und Geröll, die der Fluss im Laufe (sic!) seines Fließens in diesem Bogen abgelegt hat.
Das ganze Kies war lange Zeit in unserer Erbpacht. Nicht parzellenweise. Der ganze Uferstreifen war drei Meilen weit Bechtel-Land. Drei Generationen lang standen wir als Nutznießer im Grundbuch. Die beiden Kirchen waren die wahren Kies-Besitzer. Halb hatte es die Evangelische Pflege, halb die Katholische Schaffnei. Kein Bauer wollte solches Land haben. Denn ein Bauer braucht fette Erde. Mit dem Kies konnte keiner was anfangen. Gewissermaßen unterirdisch, verläuft das Kies unterm Zoo durch, und weiter, wo die Juhe und die Rugby-Clubs drauf stehen. Und noch ein Stück weiter. Unterm Freischwimmbad bis unters Verlagshaus ist alles Kies.
Vor den Bechtel und länger als wir Bechtel, gab es schon auf dem Kies die Kießeckers. Ob sie wirklich so geheißen haben, oder ob Kießecker nur ihr Uzname war, weil sie aus ihrem Uferstreifen nichts zu machen verstanden haben, kann ich nicht sagen. Ebenso wenig, wer zuerst auf die Idee zur Schweinezucht gekommen ist. Ein Bechtel oder ein Kießeckers. Ein Bechtel-Sohn heiratet eine Kießecker-Tochter. Von da an sind wir die Sau-Bechtel. Man muss dazu stehen, wer man ist.
Der Sau-Bechtel hatte die fettesten Säue. Seuchenfreier Bestand. Die Gülle ist direkt in den Fluss gelaufen. Jedes Hochwasser hat die Ställe durchgespült. Augias und Herakles lassen literarisch schön grüßen. Pferdeäpfel und Kuhfladen sind gutes Dünger für die Felder. Die Saugülle taugt zu nichts. Ätzend scharf wie Schwefelsäure. Und sie stinkt bestialisch. Obwohl weit draußen, verpestet sie die Luft drin im Dorf. Ob Regen, ob Wind, der Sau-Bechtel stinkt. Die Schweine waren den Fluss gewohnt. In heißen Sommern kamen sie auf eine der Inseln. Das ging drei, vier Saisonen gut, bis der Fluss kanalisiert wurde. In den Kanal durfte der Sau-Bechtel den Schweinekot nicht mehr einleiten. Das war das Ende vom Sau-Bechtel.
Mach ich die Steine zu Geld! Also hat der Sau-Bechtel umgesattelt. Als Kies-Bechtel kam er gut aus den Startlöchern. Schotter wird immer gebraucht im Straßenbau. Die Eisenbahn kam gerade zur rechten Zeit dazu. Ein Schienenweg braucht noch mehr Schotter als die Autobahn. Einfach den Schotter wegräumen. Sand gab es obendrauf.
Die Hochwasser haben jedes Jahr den Sand und den Schotter neu angeschwemmt. Die Bechtel haben sich gut gestellt. Bis ihnen die Schaffnei und die Pflege quer gekommen sind. Das geht nicht, dass der Bechtel ihren Grund und Boden wegverkauft. Am Ende ist alles weg. Nicht mal mehr Sand und Schotter. Alles weg. Kieselgrund und Sandgrube ausgeräumt bis auf Wasserhöhe. Dann säuft die Grube ab. Eine Bucht im Ufer. Das wäre was gewesen, wenn die Kies- und Bau-Bechtel kilometerweit das Ufer bis aufs Wasser abgeräumt hätten.
Dem haben die Kirchen ein Ende gemacht. Jede hat ihren Juristischen Kirchenrat geschickt. Seitdem müssen die schlausten Bechtel was Anständiges lernen. Einen, der Anwalt ist, gibt es immer in der Familie. Und einer sitzt im Rathaus. Vor hundert Jahren hat in Neudorf ein Bechtel seine Villa gebaut. Der eine Bruder hat den Plan gemacht. Der andere für die Genehmigungen gesorgt. Bauherr, Architekt und Bauamt in einer Familienhand.
Die Kirchenräte haben dem Kies- und Bau-Bechtel ein Angebot gemacht.
Der Schotter wurde von da an vom Berg abgesprengt. Der erste Berg außerhalb der Gemarkung musste dran glauben. An den Berg vom Erzengel Michael traute sich keiner. Liegt kein Segen drauf, dem Erzengel Michael seinen Berg unter den Flügeln abzubauen.
Den Schotterhandel bekam der Vetter Willem. In unserer Familiengeschichte heißt er einfach Vetter Willem. Da weiß jedes Kind, wer gemeint ist.
Er hat den Handel mit Baumaterial im großen Stil aufgezogen. Eine Seilbahn hat den Schotter aus dem Steinbruch runter in die Ebene abtransportiert. Dort wurde das Material auf Laufbändern über Siebe geführt und nach Brocken der Größe nach sortiert.
Die Schottersteine wurden in Kippwaggons umgeladen und quer durch die Felder bis zum Fluss weitertransportiert. Zwischen Zoo und Botanischem Garten in einem kleinen Hafen haben die Lastkähne gewartet. Sie sind bis in die Niederlande gefahren.
Die Trasse der Schmalspurbahn siehst du noch an manchen Stellen, wenn du im Feld spazieren gehst. Sie liegt schräg zu den geraden Feldwegen. Quer durch die Felder. Wie der Broadway in New York. Darum ist der Botanische Garten am einen Ende schräg abgeschnitten. Das war die Güterbahn. Die hellen Steinbrüche im grünen Berghang siehst du heute noch gut. Sie werden renaturiert. So heißt das.
So war das mit den Bechtel. Arme Bauern, bis einer in die Kießecker eingeheiratet hat. Mit Schweinen das erste große Geld gemacht. Erst der Sau-Bechtel. Danach mit Kies und Schotter der Bau-Bechtel. Der Steinbruch hat über beide Weltkriege gehalten.
"Ich hab noch die Loren am Stahlseil fahren sehen." Sagte Onkel Eugen. "Geknallt hat es andauernd von den Sprengungen. Als wäre das ganze Jahr Jagd."
Die alten Flurpläne von Alt- und Neudorf mit den Namen der Gewanne und Grenzen der Gemarkung haben mir gute Dienste geleistet. Achtzig Prozent haben sich Schaffnei und Pflege geteilt. Davon hatte die Pflege doppelt so viel Grund und Boden wie die Schaffnei. Das hat mit der Weltgeschichte zu tun. Und die Umverteilung in der Reformation. Die Katholischen mussten den Evangelischen abgeben. Und unsere Stadt ist von Anfang an lutherisch. Die Altsatdt hat drei evangelische Kirchen und eine einzige katholische. Und die mussten die Jesuiten sich zurückholen.
Das INF ist ein richtiger Pfaffengrund. Diesen Spitznamen hat Eugen immer gebraucht. Auch unser Viertel gehört noch dazu. Wenn ich Altneudorf sage, kann ich Eugen damit bis zur Weißglut reizen. Mit Altneudorf meine ich die Nordstadt: Altdorf und Neudorf mit dem INF-Viertel. Eigentlich hat Altdorf bis jetzt kaum Felder abgeben müssen. Neudorf hat nichts mehr. Alles Land ist verbaut.
Und dass ein Bauer fünf Äcker verkaufen muss, um einen neuen Hof auf seinen Acker zu stellen. Das höre ich Onkel Eugen immer wieder sagen. Nicht nur er mault so. Darüber maulen alle, die mal Äcker in den Feldern hatten. Egal wo. Altneudorf!Kapitel 10: LebenDie Biologie ist die philosophischste der Naturwissenschaften. Vielleicht der Wissenschaft überhaupt. Wissen ist die höchste Lebensform.
Die Lehre vom Leben ist dem Menschen auf den Leib geschnitten. Die Natur hat sich den Menschen zurechtgeschnitzt und ein Geschöpf geschaffen, das in der Lage sein soll, sich über sie Gedanken zu machen. Das Leben zu verstehen, wie es lebt, ist seine Aufgabe.
Die Singvögel konnte ich bestimmen und die Pflanzen. Auch wenn ich nicht vom Fach bin, glaube ich zu wissen, was die Biologie ist. Alle Lebenswissenschaften untersuchen das Leben, wie es funktioniert. Dass es funktioniert, erlebe ich am eigenen Leib. Ums physisch zu sagen. Und der Geist?
Die Physis ist nichts als ein Haufen Zellen. Ach was! Zellen sind schon organisiert. Ohne Geist wären wie ein Klumpen Fleisch und Knochen. Nicht mal das! Bei den Knochen habe ich noch die Idee vor Augen, dass sie sich bewegen. Noch mehr tot muss Fleisch und Knochen sein. Pures Aas für die Geier. Umso größer ist das Wunder, dass sie sich bewegen lassen.
Wer sie bewegt? Wer sonst als der Geist. Ach was! Bleib mir weg mit deinen Gelenken und Sehnen und Kontraktionen der Muskeln. Der Geist hat sich das Gelenk ausgedacht.
Was es anregt, ist – metaphysisch. Nein! Mit Religion und ihrem Glauben an Gott hat die Meta-Physik nichts zu tun. Ihnen ist sie haushoch überlegen; tà metà tà physiká. Was hinter der Physik im Regal steht. Der Ladenhüter hinter den Werken der Physik schamhaft versteckt. Metaphysik – ein sprechendes, sich selbst erklärendes Wort.
An der Biologie schätze ich ihre Bescheidenheit. Warum wir leben, darum schert sich die Biologie nicht. Um das Warum balgen sich die Religionen.
Unsere Hochschule stellt gern die Lebenswissenschaften ins Schaufenster. Und stutzt dabei dem Botanischen Garten weiter das Gelände. Die Wissenschaft des Lebens finde im Labor statt. Zur Life Science gehören noch immer die Botanik und Botaniker ebenso gut wie Chemiker, Mathematiker und Informatiker.
Die Wissenschaften des Lebens haben sich im COS neu geordnet. Das Centre for Organismal Studies erforscht die natürlichen Organismen querbeet über alle biologischen Organisationsstufen. Wie ein Organismus organisiert ist. Danach richtet sich die Klassifizierung der Pflanzen und Tiere. Ihre Gemeinsamkeiten und Unterschiede.
Aufgefallen war mir zuerst nur, dass die Biologie sich mit einem schlichten Centrum zufrieden gibt, während jeder Fußballverein sein Sport-Zentrum zu einer Academy aufwertet.
Dass der Botaniker von dem Körper einer Pflanze spricht, damit habe ich zuerst meine Schwierigkeiten. Ich habe eine ungefähre Vorstellung von meinem eigenen Organismus. Wie jeder Mensch und Zuhörer in diesem Raum. Einen Körper mit inneren Organen sehe ich auch bei den Tieren. Besonders den Säugetieren. Aus Fleisch und Blut, mit Herz und Lunge und einem Verdauungstrakt. Eine Heuschrecke scheint mir schon weniger körperlich. Alle Insekten sind eher wie Gras. Bei einer Pflanze von einem Körper und Organismus sprechen zu hören, an den Gedanken muss ich mich erst gewöhnen. Sei’s drum! Auch Pflanzen haben einen Organismus. Und nach der Organisation des Organismus systematisiert ein Botaniker seine Objekte.
Linné ist der bekannteste Systematiker. Von ihm wurden alle Pflanzen benannt. An seine Systematik halten sich alle Botaniker bis heute.
Im COS kümmert sich die Biologie um die Pflanzen und Tiere, die ich in der Schule lernen musste. Trotz aller Neuorganisation werden Flora und Fauna, also Botanik und Zoologie, nicht grundsätzlich abgeschafft. Das COS kümmert sich in 16 Abteilungen um die belebte Natur. Sie alle aufzuführen, würde zu weit vom Weg abführen. Die gängigsten sind die Evolution der Tiere, Entwicklungsphysiologie, Stammzellforschung, Zellteilung und Zellidentität.
Bei Molekularer Biologie der Pflanzen, Molekularer Evolution und Genomik, Entwicklungsbiologie, der Entwicklungsplastizität der Pflanzen, dem Zytoskelett und der Signaltransduktion müsste ich passen. Unter Tierphysiologie, Zellteilung und Entwicklungsbiologie kann ich mir ein wenig vorstellen.
Dass Botanik und Zoologie zusammengehören, wird damit bewiesen, Pflanzen und Tiere aus Zellen gebildet sind. Steine bestehen nicht aus Zellen. Sie sind einfach ein Haufen Dreck, mal mehr oder weniger fest zusammengepresst. Anders als die Geologen erforschen alle im COS die belebte Natur.
Belebt unterscheidet sich von lebend. Einmal durch den versteckten Hinweis, dass es auch unbelebte Natur gibt, wie das Kies mit seinem Sand und Geröll und den Kieselsteinen. Zweitens weist belebt auf etwas, oder jemanden, hin, der in der Lage ist, Sand, Geröll und Kiesel lebendig zu machen. Für beleben bieten sich Synonyme an wie animieren oder ins Leben rufen. Auch begeistern zähle ich zu den Wörtern, oder wie etwas erweckt wird. Alles ist erlaubt.
Meine Liebe zu Pflanzen ist stärker als zu Tieren. Ich halte sie noch immer für die bessere Wahl. Sie sind an einen Standort gebunden und Gefangenschaft gewohnt. In ihrem Garten fühlen sie sich nicht eingesperrt wie die Tiere im Zoo. Wir sprechen auch von einem zarten Pflänzchen und meinen einen zartbesaiteten Menschen.
Jetzt erinnere ich mich wieder daran. In der Schule musste ich Pflanzen und Vögel bestimmen. Als Schüler habe ich es in der Schule gelernt. So wandern die Gedanken herum. Während ich querbeet durch das INF gehe.
Der Botanische Garten ist nicht nur ein Park.
Wir gehen im Garten spazieren und wundern uns über Pflanzen, die wir im Regal für Obst, Gemüse und Blumen nicht finden. Anfangs wollte ich mich vom Schul- und Lehrgarten unterrichten lassen. Nach wenigen Versuchen gab ich es auf. Ich gehe keinen Schritt mehr an die Bäume und Büsche und Gemüsesorten heran, um nachzulesen, wie sie heißen. Ich wundere mich jedesmal, dass die Botaniker vorgeben, alle diese Namen zu kennen.
Ich sehe überall Gärtnerinnen und Gärtner. Ob sie alle Botaniker sind? Sie tun nichts anderes als die Mütter und die Väter, wenn sie nach dem Haushalt und der Arbeit am frühen Abend in den Garten gingen. Um zu gärtnern, zu gärteln. Sie nahmen sich Hacke und Rechen. Sie steckten Beete ab, in die sie ihr Gemüse pflanzten. Manchmal nahmen die Frauen den Spaten, wenn die Männer nicht richtig gegraben hatten, nicht tief genug, oder die Schollen nicht klein genug geschlagen hatten. Schlecht geschoren war. Sie machten sich die Erde passend. Sie sind nicht nur zur Erholung im Garten. Was treibt ein Botaniker, wenn er keine Pflanzen bestimmt? Oder gärtnert?
An einem Sonntagvormittag besuche ich eine Matinee im Botanischen Garten. Ich steige nicht das Alpinum hinauf. Auch nicht, um mich im Lehrgarten belehren zu lassen. Und auch nicht, um an den Gewächsen meine Freude zu haben. Ich betrete schnurstracks ein Haus. Im Gebäude INF361 ist es angenehm kühl. Der Raum ist abgedunkelt, schwarze Vorhänge sind vor die Fenster gezogen. Draußen ist es heiß, dass eine späte Zuhörerin die Verdunkelung aufreißt und die Tür öffnet, dass die drei letzten Reihen im Gegenzug sitzen. "Wir wollen doch keine Ohnmachten." Dagegen findet keiner ein Argument.
"Wie Pflanzen atmen & dabei das Weltklima beeinflussen."
Der Vortragende knappst sich ein Viertelstündchen von seiner Vortragszeit ab und jagt eine Sequenz der "Temperature Anomalies by Countries 1880-2017" über die Leinwand. Zu Anfang sind die Veränderungen der Temperaturen moderat. Es zeigt sich ein freundlich gelber Fleck für jedes Land. Zum Schluss lässt er die Jahrzehnte durchsausen. Hundertdreißig Jahre rauschen in fünf Sekunden vor unseren Augen vorbei und verwandeln die Länder in ein feuerrotes Inferno. Diese Sauserei macht uns alle baff. Ein kleiner, leiser Laut der Überraschung im Chor. Und weckt nach einer halben Schrecksekunde unseren Widerspruch auf. Das Thema ist nicht verhandelbar. Schuld sind wir, weil wir Fleisch essen. Dann beginnt der Vortrag, zu dem wir gekommen sind: "Wie Pflanzen atmen".
Pflanzen sind unser Primärkontakt mit der Natur. Tiere sind sekundäre Natur. Ihre Körper sind höher organisiert. Und stehen über den Pflanzen in der Nahrungskette. Keine Pflanze ernährt sich von Tieren.
"Und die Fleischfressenden?" Es ist die Dame, die keine Ohnmachten will.
Er winkt ab. Gute Frage. Aber das Thema ist im Oktober dran. Es würde zu weit führen und ab vom Thema. Da fühle ich mich wie ein Schüler und lehne mich zurück.
Pflanzen atmen und ihr Atem beeinflusst das Weltklima. Meere und Seen sorgen dafür, dass es regnet. Ihr Wasser verdunstet. Steigt in die Luft und kommt als Regen wieder auf die Erde. Die Hälfte des Regenwassers kommt von der Verdunstung der großen Gewässer. Die andere Hälfte des Weltwassers kommt von den Pflanzen. Sie sorgen selbst dafür, dass sie nicht vertrocknen. Damit der Boden, in denen sie ihre Wurzeln schlagen, nicht versandet. Oder verhärtet zu Backstein, terra cotta sagen die Italiener, gebackene Erde.
Wie atmen Pflanzen? Und wie wollen sie das Weltklima beeinflussen können? Das untersucht dieser Botaniker. Wo keine Pflanzen wachsen, regnet es auch nicht. Wo doch die Pflanzen Wasser so nötig haben. Sonst vertrocknen sie. Wenn ich verreise, bitte ich die Nachbarin, nach ihnen zu sehen. Die Pflanze nimmt CO2 und macht Wasser daraus. Der Mensch nimmt Wasser, und übrig bleibt CO2. Und es werden immer mehr Menschen, die das tun. Sie alle wollen Fleisch essen. Und ein Dach überm Kopf. Wo ein Haus steht, wächst kein Baum mehr. Und wo Rinder weiden, wächst auch kein Gras. Die Gärtchen zwischen den Häusern zählen nicht. Sie fallen nicht ins Gewicht im Haushalt von H2O und CO2.
Das Verhältnis von Pflanze und Mensch lässt sich durch CO2 und H2O nicht schöner ausdrücken. Gemeinsam bestimmen sie das Weltklima. Und seinen Wandel. Es müsste eine Pflanzenexplosion geben, wie es eine Bevölkerungsexplosion gibt. Damit das Klima sich nicht ändert. Solch eine Balance verlangt eine große Geschicklichkeit. Ich kenne es vom Turnen. Einmal aus dem Gleichgewicht, und du knallst auf die Nase.
Wie schaffen es die Pflanzen, so viel Wasser in die Luft zu schicken, wie Regen vom Himmel fällt!
Durch Stomata. Diese Spalten in den Blättern, aus denen sie H2O freigeben. "Wie ausspucken?" fragt die Dame, die für frische Luft gesorgt hat. Kopfschütteln, über so viel Unverstand.
Wir sammeln uns wieder. Der Redner räuspert sich. Also Stomata! Dann geht der Vortrag weiter. Wie die Pflanzen ihre wasserspendenden Spalten bilden.
Durch undifferenzierte Stammzellen bildet die Pflanze ihren Körper. Nach einer ersten Phase der Körperbildung beginnt eine zweite Phase der Zellteilung. Sie setzt nicht in allen Zellen ein, sondern nur in bestimmten Regionen am Pflanzenkörper. In diesen sogenannten weichen Partien spezialisiert sich die Pflanze, das heißt, sie bildet bestimmte, ganz gezielte Fähigkeiten aus. Etwa die Samenzellen, die für den Erhalt der Pflanze und Fortpflanzung (sic!) sorgen. Durch diese Teilung segmentiert sich die Pflanze in ihren Teilen, die mit den Organen beim Tier vergleichbar sind. Nur an einzelnen, punktuellen Stellen differenziert sich die Pflanze. Selbst ein schmaler Grashalm bildet Wurzeln, Stängel, Blätter, Blüte, Samen. Jedes Gras blüht. Auch wenn wir die Blüte nicht wahrnehmen, weil sie winzig klein sind. Das Getreide ist Gras. Das so verändert ist, dass seine Samen sich zu Körnern auswachsen.
Nicht die ganze Pflanze ändert sich, nur an bestimmten, weichen Punkten. Diese weichen Partien gibt es auch beim Wachstum. Die Zellen, die für Veränderungen sorgen. Und welche, die für den Erhalt der Identität der Pflanze sorgen. Die Pflanze bleibt in ihrem Wesen unverändert. Jede Zellart hat ihr eigenes genetisches Programm, nach dem sie agiert. Neben diesen Haupt- oder Stammzellen hat jede Pflanze Samenzellen zur Arterhaltung und Fortpflanzung. Nach einem andern genetischen Plan bilden die Pflanzen ...

"Tun das alle Pflanzen?" hakt die Dame der Frischluft und Helligkeit ein.
... bilden die Pflanzen an den Unterseiten ihrer Blätter durch Zellveränderung Spalten, die Stomata. Durch sie atmen die Pflanzen Wasser aus. Das können grundsätzlich alle Pflanzen. Der halbe Wasserhaushalt der Erde wird von Pflanzen in Umlauf gebracht. Die Pflanzen sind so wirkungsvoll wie Ozeane, Seen und Flüsse.
"Das Wasser trinken sie durch die Wurzeln." Sagt die muntere Zuhörerin. Sie ist ganz von sich begeistert.
Zwei, drei Bio-Lehrer im Ruhestand müssen unter uns sein. Sie stellen Fangfragen, die dem Vortragenden Gelegenheit geben zu glänzen. Das letzte Wort hat die Dame der Frischluft. Sie gesteht, dass sie vieles nicht verstanden hat. Wir atmen auf, dass der Vortragende auf die Uhr verweist. Die Zeit sei abgelaufen. Zuletzt dankt unser Beifall dem Redner. Der Gastgeber, das Botanische Institut und der Botanische Garten in Person ihres Leiters, lädt zu den "Fleischfressenden Pflanzen" im Oktober ein. Bis dahin gibt es keine Vorträge. Dem Sommer und den Urlauben geschuldet.
Es ist der fünfte heiße Sommer. Aber nach meiner subjektiven Wahrnehmung mit etwas mehr Niederschlägen als die letzten drei. An die früheren erinnere ich mich nicht mehr. Ich vergesse schnell, wie der letzte Winter war. Mit oder ohne Schnee. Mit oder ohne Frost. Für mich spielt das Wetter keine Rolle. Wer einen Garten hat, ist da wahrscheinlich anders. Gärtner und Bauern sind es ganz sicher.Kapitel 11: StandorteIn Wahrheit gehe ich nur ungern in unsere Felder.
Kann der Natur nichts abgewinnen. In der Natur passiert nichts, was nicht seit Jahr Millionen passiert. Die Hasen paaren sich. Und wenn sie nicht aufpassen, holt sie der Fuchs. Zur Abwechslung mal raus aus dem Neuen Campus, der kein Feld mehr ist! Dem INF aus dem Weg gehen! Die Augen sollen anderes zu sehen kriegen. Will den Kopf frei bekommen.
Hinein in die Altstadt! Nicht ins Nachtleben! Bei hellem Tag und Sonnenschein mitten hinein unter die Touristen. Anonym und unbeachtet die Freude an der Stadt genießen.
Mir geht der Botanische Garten nicht aus dem Sinn. Ich schleppe ihn mit mir als eine chronische Erkrankung. Er steckt mir in den Knochen.
Ich neige dazu, vom Botanischen Garten im Plural zu sprechen. Die Altstadt bietet mir die Möglichkeit, den Anfängen der Botanischen Gärten nachzugehen. Ihre Standorte verfolgen. Und wie es dort heute aussieht. Die Botanischen Gärten wurden schon immer vorausgeschickt. Als nützlicher Vorreiter für die Stadterweiterung. Sieben Standorte habe ich gefunden. Der achte ist schon katastriert. Das Bauamt besitzt ein Papp-Modell. Der achte Garten überschreitet eine Grenze.
Das alte Gefängnis der Stadt heißt Fauler Pelz. Es ist nicht der historische Studentenkarzer in der Alten Uni. Der Faule Pelz liegt unterhalb vom Schloss, knapp über der Altstadt. Auf dem alten Eisenbahntunnel. Der 33er Bus, der ins Flusstal fährt, schwenkt vor dem Tunnel rechts ab und fährt den Oberen Faulen Pelz lang. Das Gefängnis hat eine eigene Haltestelle. Das Haupttor liegt am Unteren Faulen Pelz. Scheint eine alte Tradition, Straßen nach lokalen Gegebenheiten zu nennen. Es gibt auch eine Vordere Mühlgasse. Und einen Unteren Lauer.
Unter den drei Blockbauten aus rotem Sandstein liegt der erste Botanische Garten. Begraben liegt mir auf der Zunge. Dem Faulen Pelz sind alle Fenster vergittert. Sind eigentlich nur Oberlichter. Auf den Mauern, die die Gebäude einschließen, liegen noch immer Rollen Stacheldraht. Auch Kameras entdecke ich an den Ecken der Gebäude. Muss Eugen fragen, wer inzwischen drin wohnt. Das Gefängnis ist seit Jahren aufgelassen. Studierenden-Wohnheime oder Touristen-Hotel? Der Faule Pelz gehört dem Land. Und könnte auch als Verwaltungsgebäude der Hochschule zur Nutzung überlassen sein.
Ich gehe weg vom Schloss stadteinwärts. Je nach dem, was sich wie Stadtmitte anfühlt. Durch eine der schmalen Gassen, die parallel zur Hauptstraße laufen. Quer über den Uni-Platz. Vorbei an der Mensa Cafeteria mit meinen Verrückten.
Ich gehe die Grabengasse runter. Sie ist die Grenze zwischen Altstadt und Vorstadt. Der Graben entlang der Stadtmauer. Davor lag die Sandgrube. Die Sandgasse erinnert daran. Ich nehme die Hauptstraße. Historisch gesehen bin ich schon wieder über den Kern der alten Stadt hinaus.
Im Schafhäuter trinke ich einen Kaffee. Der Schafscherer öffnet um 10 Uhr. Das Café hat umgebaut, ein Drittel gut bürgerlich, ein Drittel im Bistro-Stil. Ich gehe bis ganz nach hinten durch. Bis 11 Uhr ist der Wintergarten leer. Ich habe freie Auswahl. Dieses kleine Stückchen Garten mitten im Herzen der Altstadt ist das Juwel. Touristen finden da nicht rein. Sommers stehen Tische draußen auf der Hauptstraße. Auch mit Bedienung. Die Bedienungen in Schwarz mit weißen Schürzen. Ich sitze allein, bestelle einen Espresso Macchiato und einen Windbeutel. Schaum und Schlagsahne tun meinem nervösen Magen gut.
Ich fühle mich wunderbar. Ein Paradiesgärtchen. Ich genieße die Ruhe, das Grün tut den Augen gut. Ich taste mit den Augen die Bäume, Büsche, Blumen ab. Wenn ich nur ein besseres Gedächtnis dafür hätte. In der Schule gab es immer eine Viertelstunde Bestimmung von Pflanzen und Tieren. Das Kopfrechnen der Biologie.
Warum bin ich hier?
In diesem Café-Paradies glaube ich Krümel des zweiten Botanischen Gartens zu erkennen. Die Turmuhr der Kirche nebenan schlägt Dreiviertel. Sie steht mitten im alten Kräutergarten. Auf der andern Seite das Theater der Stadt. Nur ein kleiner Teil war für Heil- und Küchenkräuter reserviert. Der Garten eher ein Paradeplatz. Um die Pferde zu bewegen.
Ein halbes Stündchen gönne ich mir und phantasiere. Ab 11 Uhr kommen die Gäste. Ich zahle und nehme den Seitenausgang zur Plöck. Noch so ein seltsamer Name für eine Straße.
Vom dritten Standort ist nichts mehr zu sehen. Nicht das kleinste Fitzelchen. Nicht der winzigste Krümel. Der Platz, zu Ehren des ersten demokratischen Präsidenten Ebert benannt, ist gnadenlos trist. Sein Pflaster ist die Decke einer Tiefgarage. Wäre der öde Platz bepflanzt, das Gießen der Pflanzen setzte wohl jedes Mal die Stellplätze unter Wasser. Oben Rasensprenger, unten Sprinkler Anlage. Erhalten geblieben ist sein Format. Zwischen Plöck-Straße und Anlage. Geschätzte anderthalb Sportplätze der Länge nach. Mittwochs ist Markt.
Der vierte Botanische Garten hat die Dominikaner ihr Kloster gekostet. Die Calvinisten haben das Gebäude platt gemacht für einen Garten.
Ein Kloster hat immer einen Klostergarten, einen Garten mit Heilkräutern und Küchenkräutern. Diesmal mussten Gebäude der Vergrößerung des Gartens weichen. Der Nutz- und Kräutergarten wurde zu einem Renommiergarten ausgebaut. Dreißig Jahre hat der vierte Garten ausgehalten. Dann wurde er der Anatomie geopfert. Die baute ihr Institut mit dem Großen Seziersälen und den Kammern im Eiskeller.
In dieser Alten Anatomie hausen heute die Psychologen. Davor steht aufrecht, mit leichtem Ausfallschritt der Physiker Robert Bunsen, der dem von seinem Assistenten Desaga erfundenen Brenner den Namen gegeben hat. Bunsen, den ich dem Aussehen nach immer für Goethe gehalten habe, schaut zu dem Gebäude hinüber, in dem er einmal gewohnt und experimentiert hat.
Ein weiteres Mal musste der Garten den Vorreiter spielen. Go west! Die Stadt schickte ihn vor das Stadttor. Am Ende der Hauptstraße begann die Mannheimer Allee. Darum heißt es auf alten Plänen das Mannheimer Tor. Einen Bismarck gab es noch nicht, und keinen Platz, um ihn zu ehren. Dorthin ist der Garten umgezogen. Der Stadtgarten, um den der Autoverkehr tobt, ist ein kleiner Rest. Einen Vorteil hat der Botanische Garten aus seiner Mobilität gezogen. Mit jeder Vertreibung ist seine Grundfläche größer geworden.
Dieser fünfte Botanische Garten lag in einer aufgegebenen Sandgrube. Der Alte Bahnhof und der Botanische Garten lagen nebeneinander. Durch die Straße nach Rohrbach getrennt.
Der erste Bahnhof war ein Kopfbahnhof in einer Sackgasse. Er lag am Rande der Stadt und verqualmte die noblen Hotels. Den Bayrischen Hof, den Europäischen, das Schrieder und die Alte Polizei. Auch das Hotel Viktoria, die Parteizentrale im Dritten Reich. Die Königin von England hat dem Hotel ihren Namen gegeben. Nicht der Wille zum Sieg. Heute ist es das Juristische Seminar. Dieser Garten reichte von der Galerie Kaufhof bis zur Deutschen Bank. Auch das Amerika-Haus steht auf Botanischem Gartengrund. Die Plöck-Straße geht querdurch, wie zu Gartenzeiten.
Der Garten war zu Goethes Lebensende, 1832, hier angekommen. 1880 wurde er weiter hinaus geschoben nach Bergheim. Immer der Längsachse entlang gen Westen. Links und rechts der Hauptstraße. Ihre Fortsetzung war die Mannheimer Chaussee. Sie heißt heute nach dem Stadtteil.
In Bergheim an der Bergheimer Straße bekam der Botanische Garten seinen sechsten Standort. Bis die Innere Medizinische Klinik auf seinen Platz gesetzt wurde. Als die Innere Medizinische in Bergheim aufgegeben wurde und ins INF kam, bekamen die Ökonomen das Gebäude. Die frühere Ludolf-Krehl-Klinik heißt jetzt Alfred-Weber-Institut.
An seinem sechsten Standort wurde die Botanik eine eigenständige Wissenschaft. Nicht mehr nur pharmazeutisches Hilfsmittel der Medizin. Hier arbeitete Wilhelm Hofmeister, nach dem die Straße im Neuen Campus INF benannt ist. Er war der erste Nicht-Mediziner als Direktor des Botanischen Gartens. Ein Jahrzehnt vor Darwin hatte Hofmeister die Verwandtschaft der Gewächse nachgewiesen. Eine Deszendenztheorie der Pflanzen. Hofmeister hatte kein Abitur, hatte nicht studiert, er war gelernter Buchhändler und Verleger für Noten in Leipzig. Über die Köpfe der Fakultät weg wurde er auf den Lehrstuhl für Botanik der Universität gesetzt.
Sein Alpinum hatte die ganzen Jahre überlebt. Als man die Klinik zu einem Institut umgebaut hat, wurde das Alpengärtchen unterm Bauschutt begraben.
Immer diente der Garten als Vorläufer für eine Bebauung. Ich will das nicht bedauern. Ein Gärtchen für die Heilkünstler ist der Garten der Botanik längst nicht mehr.
Wenn ich in der Stadt spazieren gehe, begleiten mich diese Gärten. Zuletzt, zu vorletzt, wurde er über den Fluss gezwungen. Als hätte die Stadt nichts mehr mit ihm zu tun.Kapitel 12: BriefwechselImmer wieder schleppt er mich ins Archiv. Eugen zeigt mir einen Brief. Das Schreiben No. A 12833 liest er laut vor. Halb höre ich, halb lese ich.
Der Brief ist mit Maschine geschrieben, vom Ministerium des Kultus und Unterrichts Karlsruhe vom 9. Januar 1913 an den Stadtrat unserer Stadt. Er betrifft "die Erwerbung von Gelände für die Universität".
Das Ministerium beabsichtigt, "wenn irgend möglich, mit der Verlegung des botanischen Gartens ... im November dieses Jahres zu beginnen. Es sollte daher .... der Mönchweg bis zur Güterbahn tunlichst bald durchgeführt werden, damit eine günstige Zufahrt vorhanden ist. Vorausschauend sollte der Mönchweg auch im Namen höher gestuft und künftig als Straße in den Lageplänen ausgewiesen werden. Der Beibehaltung von Mönch steht nichts im Wege. Wir bitten um gefällige Mitteilung, zu welchem Zeitpunkt wir auf die Ausführung der Straße rechnen dürfen.
Von der Erklärung der Bereitwilligkeit, uns die im Eigentum der Stadt stehenden Grundstücke Lagerbuch No. 6111a, 5919a und 5923 zum Einheitspreis von 3.50 M pro qm bei Bedarf abzutreten, haben wir Kenntnis genommen; wir danken für das freundliche Entgegenkommen. Das Grundstück Lagerbuch No 5919a ... wird im November dieses Jahres gebraucht werden. Nähere Mitteilung hierwegen behalten wir uns noch vor; ebenso hinsichtlich der beiden anderen Grundstücke Lagerbuch No. 5923 und 6111a.
Wir haben das erforderliche Gelände uns nunmehr im Wesentlichen gesichert. Nur zehn Grundstücke haben wir nicht freihändig erwerben können; wir werden hinsichtlich dieser die Einleitung des Enteignungsverfahrens beantragen."
Die Unterschrift könnte heißen Böhm, Böhmer, Böhmann. Mit R wäre es Röhm, Röhmer, Röhmann. Der Umlautvokal im Wortstamm ist zweifelsfrei ein ö.
Darunter ist noch ein handschriftlicher Vermerk. Den liest er mir vor. Was er mir vorsagt, versuche ich, mit dem in Übereinstimmung zu bringen, was ich sehe. Hier seine Transkription des Sütterlin.
Den 10. Januar 1913
An Herrn Landwirt Peter Ruppert, Senior.
Wir benachrichten sie als Pächter des Grundstücks. L.B.N. 5919a. 16a, 62 qm, (Acker), Naturland in dem Gewann Neusatz, dass dieses Grundstück voraussichtlich im November diesen Jahres ...benötigt werden wird, behalten uns aber als Kündigung des Kaufverhältnisses noch vor.
Wir lassen uns das Lager-Buch bringen. Vorn auf dem Folio-Band ist steht in Schwarz Stadt-Rat der Kreishauptstadt. Dazu mittig der stehende Löwe, nach links gewendet. Nachträglich ist die Archiv Nr. 272 Fasc. 2 aufgestempelt, mit roter Tinte. Die Faszikel Nummer 2 ist nachträglich schwarz von Hand eingetragen. Es handelt sich bei unserer Anfrage um die Rubrik XXII. Auf derselben Linie, aber in der Mitte, lesen wir von Hand geschrieben Polizei. Ich schaue Onkel Eugen fragend an. Er zieht die Schultern hoch. "Später", sagt er. "Mach voran!"
Darunter steht noch handschriftlich Nr. 5. Bau- und Flurpolizei. Darauf zeigt Eugen mit dem Finger. Und weiter die Zeilen entlang, laut vorlesend: Die Erstellung von Universitäts-Instituten auf dem rechten Neckarufer, hier insbesondere der Festsetzung der Bau und Straßenführung für dieses Gebiet südöstlicher Teil der ehemaligen Gemarkung.
Jahr: 1912/1913
Dieser letzte Absatz ist durchgehend fett unterstrichen. Aber nur der Unterstrich in fett. Interpunktion und Unterstreichungen sind genau so, wie ich sie hier wiedergebe. Und kein Jota anders.
Mit der ehemaligen Gemarkung ist Neudorf gemeint. Es wird nach der kurz vorher erfolgten Einstädterung nun als Stadtteil behandelt. Neudorf hat seine Selbstständigkeit als freie Gemeinde verloren.
Wir schlagen das Lager-Buch auf und finden ohne Schwierigkeiten die Eintragungen zu No. 6111a, 5919a und 5923.
Der angesprochene Acker Nr. 5919a, der uns interessiert, liegt im Neusatz. Im Gewann Neusatz. Neusatz besagt, dass es hier früher einmal eine große Neuanpflanzung gegeben hat, Pflanzen neu gesetzt worden sind. Noch bevor der Botanische Garten mit seinen Pflanzen hierher versetzt wurde. Er hat Gewächse, Sträucher und ganze Bäume aus Bergheim mitgebracht. Was nicht niet- und nagelfest verwurzelt war. Nur das Alpinum ist dort geblieben. Und wurde durch eine neue alpine Flora ersetzt.
Weiter haben wir in Folge dieses archivierten Briefentwurfs noch viele andere Nutznießer herausgefunden.
Es erscheint mir aber müßig, alle Ackerbesitzer aufzulisten Da hätte ich mir die Finger wundgeschrieben.
Jener am 10. Januar 1913 angeschriebene Landwirt Peter Ruppert, Senior, mit dem inkriminierten Acker Flurstück Nr. 5919a, ist Birgits Urgroßvater. Vielleicht auch ein Urgroßonkel. Könnte auch ein Ur-Ur sein. Ob Onkel oder Vater, da stellt sich das Einwohnermeldeamt stumm. Von diesem Peter Ruppert Senior stammt jener Jakob Ruppert ab, der gemeinsam mit dem Zimmermann, Michel, nach dem ich getauft bin, das MPI Jahnstraße 29 hochgezogen hat, damals noch als Gebäude der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft. Der eine als Bauunternehmer, der andere als Metallbauer. Wobei hochgezogen nach heutigem Maßstab ein Flachbau ist. Auch ein Backstein-Bau braucht ein Stahl-Skelett. Soweit ich was vom Bau verstehe.
Genealogie ist gar nicht so einfach. Schon gar nicht so simpel, wie es sich die, die gerade leben, vorstellen. Bereits unsere Namen sagen nichts mehr über die ausgeübten Berufe aus. Und kaum etwas, wie wir miteinander zusammenhängen.
Eugen ist nicht wirklich mein Onkel und ich nicht wirklich sein Neffe. Nicht in dem einfachen Sinn, dass er Bruder meines Vaters oder meiner Mutter wäre. Auch eine Generation früher sind unsere Eltern noch nicht oder schon nicht mehr miteinander verwandt. Für die Kinder meiner Cousins und Cousinen aber bin auch ich ein Onkel. Genverwandte sind wir schon. Aber was spielt das schon für eine Rolle. Wir sind so viele Bechtel. Zu viele.
Wären wir reicher oder hätten was zu sagen in der Stadt, wären wir eine Dynastie. Wir Bechtel sind nur noch viele. Viel zu viele, um unbemerkt zu bleiben. Und zu tief verwurzelt.
Kapitel 13: WadenwickelAm unteren Ende des Mathematikons steht Cousin Werner und predigt dem Verkehr.
Seit letztem Sommer hat Werner hier seinen Auftritt. Sonst versteckte er sich in den Büschen vor dem alten Zentrum für Mathematik, INF288. Da ist jetzt Baustelle. Zum Schlafen verkriecht er sich ins Gebüsch zwischen der alten Mathematik und der renovierten Chemie. Seinen Besitz hat er in kurzem Abstand abgestellt. Daran würde sich keiner vergreifen. So massig und schwer wie der Koloss selbst. Ein Fahrrad. Umgebaut und zum Lastesel.
Er haust schon seit Jahren in Sichtweite zum ausufernden Rest der Mönchstraße, die hier verbreitert ist zu einer Plaza, direkt vorm Theoretikum. Er stellte morgens einen leeren Kaffeebecher als Bettelschale an den Wegrand und verlangt so sein Frühstück. Den Becher bekommt er im Erdgeschoss der Zentral-Mensa. Sie öffnet die Eingänge wie meine, am Uni-Platz, um 7 Uhr.
Er hatte im Laufe der Jahre fünf Plätze, wohin er sich zurückzog. Zur Nacht. Bei schlechtem Wetter war es ein anderer als bei Sonnenschein und an milden Abenden. Im Winter hatte er ein Dach überm Kopf, neben dem Café Botanik. Bei Frost fand ich ihn frühmorgens im Vorraum der Sparkasse. Draußen war es noch dunkel. Die Nacht hatte es geschneit. Die Temperaturen unter null. Es war rein zufällig. Ich wollte an den Geldautomaten. Er hatte sich davor so breit gemacht, dass ich über ihn wegsteigen musste. Der Koloss ist aufgewacht und ganz wild geworden. Ich habe es dann sein lassen. Und bin ins Kolleg gegangen. Er lebt, wie das Leben sich in ihm verwirklichen will.
Sein letzter fester Wohnsitz im INF ist diesen Sommer Baustelle geworden. Ein AudiMax muss her. Die Baufirma hat vor wenigen Wochen sein Gehege abgesperrt. Und ihn aus seiner Idylle vertrieben. Darum steht er nun vorn. So nahe an der Öffentlichkeit habe ich ihn bisher nicht gesehen. Gegenüber der Haltestelle Neues Gymnasium hat er seine persönliche Speaker‘s Corner. Es ist der verbliebene Stummel vom früheren Mönchweg, der versackt vor dem Neuen Theoretikum. So weit weg von seinem ersten Standort steht er gar nicht. An einen Pflanzenkübel hat Werner sein monströs überladenes Fahrrad gelehnt. Sein Standort ist die mittlere Einfahrt ins INF. Hier überqueren alle Studierenden der Mathematik, Medizin, Chemie und Physik die breite Berliner Straße. Die Ampel stoppt den Verkehr. Mal längs, mal quer. Ein ideales Plätzchen, um den Menschen ins Gewissen zu reden.
Cousine Violetta schaut jeden Tag nach ihm. Das hilft zwar nicht. Aber sie gibt nicht auf. Es liegt auf dem Weg, sagt sie. Sie verdient ihr Geld in einem dieser INF-Klötze. Damit eins klar ist: Violetta und Werner sind einander so wenig Cousine und Cousin wie Eugen und ich einander Onkel und Neffe. Sie haben vor dem Altar und dem Standesamt versprochen, einander beizustehen. Vor Jahren ist er hier gestrandet. Seither treibt er sich im INF herum. Eine Art weißer Mann und Gespenst. Und erschreckt dank seiner Größe die Menschen.
Cousin Werner trägt kurze Hosen bis in den Winter. Seine Waden sind mit sauberen weißen Binden gewickelt. Wadenwickel nennen ihn meine Schüler. Sie nennen ihn auch Kommissar Maigret. Bereits in meinem Referendariat ist er im Campus aufgekreuzt ist. Da trug er noch einen schwarzen Anzug und einen Bowler auf dem Kopf. Die hat ihm wohl Violetta herausgelegt. Jahrgänge von Schülern machen sich inzwischen über ihn lustig. Sie haben keine Ahnung, wer er wirklich ist.
Inzwischen trägt er sommers eine bayrische Krachlederne mit Lederhosenträgern und Brustriemen mit Edelweiß und Enzian verziert. Die reichen knapp ans Knie. Die dicken Waden mit weißen Binden umwickelt statt grauen Strümpfen mit bayrisch weißblauen Mustern. Ein bayrischer Maigret. Dieser krachlederne Wadenwickel ist Cousin Werner. Auch er ist so ein Cousin, wie Eugen ein Onkel. Geschieden, wieder verheiratet und die Familien neu gestrickt.
Anders als der Hänfling Onkel Eugen ist Wadenwickel ein wahres Drum. Er kann einem schon angst und bang machen. Er ist eine schwerfällige Erscheinung mit einem zeremoniellen Gehabe, langsam, bedächtig und prahlerisch. Er würde einen prima Papst und Präsidenten verkörpern. Meine Schüler haben ihn erfunden und es ihm angedichtet. Mit ihrem Spott verzetteln sie ihren Respekt.
Spott kann ihm nichts anhaben. Ein Präsidentenpapst spannt seine Muskeln und setzt einen Atemzug aus. Dann ist er wieder die Ruhe in Person. Das wird ihm als Gelassenheit gutgeschrieben. So hat er schon daheim in einem schiefen Licht gestanden. Als er das Bass-Horn geblasen hat. Das Recht auf die Tuba war in einer anderen Familie.
Wadenwickel strotzt vor Gesundheit. Eine Kraft, 100 Kilo stark. 1,85 Meter Muskelmasse. Er könnte ein runtertrainierter Gewichtheber vom Olympiastützpunkt sein. Sein bestes Kampfgewicht waren drei Zentner. Damit hätte er seinen Olympiasieg machen können. Wenn er isch nicht selbst in die Quere gekommen wäre. Jetzt hat er auf zwei Zentner abtrainiert, eine fast normale Erscheinung, mit der er ein unauffälliges Leben führen könnte. Bei einem Drittel Substanzverlust brauchte er eine komplette neue Garderobe.
Angefangen hat er mit Rugby. Er war zu faul zu laufen. Im Stehen hätte er für eine Olympiade zum Stärksten der ganzen Welt werden können. Natürlich ist jetzt viel in ihm kaputt. Besonders die Knie.
Er hat die Lebenswissenschaften studiert. Er wurde noch examiniert, gleich danach zwangsexmatrikuliert. Und exiliert.
Jetzt haust er mit Sack und Pack im Gelände. Bei schlechtem Wetter und Kälte kampiert er unter dem Vorbau der Mensa neben dem Café Botanik. Im Hochsommer steckt er hinter den Hecken bei den alten Mathematikern.
Das Familienalbum zeigt ihn als jungen Mann. Groß und muskulös, mit breiten Schultern, braungebrannt, schwarze Haare wie aus Draht. Auf frühen Fotos aus seiner Schulzeit über den Augen ein ausgeprägter Wulst, aus dem seine hohe Stirn steil aufsteigt.
Die ersten Jahre hatte er einen Fotoapparat vor der Brust baumeln. Er hat alles fotografiert. Ich vermute mal, er hatte keinen Film eingelegt. Ich hatte ihn damals noch gar nicht im Visier. Wie das heute ist, kann ich nicht sagen. Er hängt an alten Dingen und trauert, als hätte er seine Vergangenheit verloren.
Wenn ich ihn ansprechen wollte, würde er unwirsch reagieren. Und wendet sich ab. Wehe, einer fasst ihn an! Ich lasse ihn schon lange in Ruhe. Sollen andere ihre Erfahrungen mit ihm machen.
Manchmal wankt er ein wenig, bewegt den schweren Körper vor und zurück wie ein Jude vor der Klagemauer. Vor und zurück, hebt die Rechte, legt die Linke zurück aufs Pult, zu dem ihm der Verteilerkasten dient, nickt, schüttelt den dicken Schädel, sanft und energisch durch seine Schwere. Alles geschieht behutsam und friedlich.
Ich habe mich neben ihn gestellt, unauffällig wie ein harmloser Fußgänger. Wie leise er vor sich hinsprechen kann. Ich habe zugehört. Und musste doch alles von seinen Lippen lesen. Er sprach mit Emphase. Wie einer jemandem gut zuredet oder ins Gewissen. Ich hatte den Eindruck, er will überzeugen. Irgendjemanden auf seine Seite ziehen. Für sich gewinnen? Plötzlich spricht er laut, als redete er gegen den Lärm des Verkehrs. Ich dachte, er nimmt uns also doch wahr. Hätte ihn gern mal am Ärmel gezupft. Nach ein paar Tage nochmal die Probe aufs Exempel. Er sah mich nicht mal an. Mit seiner großen Körperkraft hat er mich von sich geschnippt. Auch die alle Nase lang näher kommenden, an uns vorbei fahrenden und ins Klinikum abbiegenden Krankenwagen, Notarzt, Feuerwehr, konnten ihn nicht abbringen von seinem Thema. Er lässt sich nicht stören. Hat geredet und geredet. Ohne Punkt und Komma. Er sprach einfach in die Luft hinein. Ich sagte in seine Richtung: Wir sind Cousins. Ums siebte Eck. Ich benutzte das Eck und nicht die Ecke. Das Eck ist den Menschen hier vertrauter. Die Ecke würde hier keinen Sinn gemacht haben. Er hat nicht reagiert. Luft war ich. Er hat weitergeredet. Ein Pfarrer lässt sich auch nicht aus dem Konzept bringen. Ich habe ihn nochmal am Ärmel gezupft. Er hat meine Hand weggeschlagen. Mit einer Kraft, auf die ich hätte gefasst sein müssen. Nochmal traute ich mich nicht. Ich muss das Reden übernehmen. Einige meinen, er habe einen kräftigen Bass-Bariton und tauge zum Sprecher in Radio und Fernsehen.
Ich lese von seinen Lippen Hühnerstein. Was keinen Sinn ergibt. Hühnerstange? Dann sagt er ganz deutlich Hühnerstang‘. Verschluckt das e. oder doch Hühnerstall? Hühnerstall, Hühnerstein, Hühnerstange. Unaufhörlich leiert er das Wort wie eine Gott im Himmel beschwörende Litanei.
Stein? Stall? Oder doch Stang‘?
Dann liest es sich wieder ganz eindeutig von den Lippen: Hühnerstein. Onkel Eugen wird mir diese Wörter erklären müssen.
Cousin Werner bewegt sich schwerfällig und langsam, dass er fast feierlich erscheint. Wenn er so festlich dasteht, die Linke auf den Verteilerkasten gelegt, mit der Rechten lässig an der Seite, scheint es, als halte er einen Vortrag. Gelegentlich nimmt er die Linke vom Verteilerkasten. Mit der Rechten unterstreicht er mit sparsamen Gesten seinen Vortrag. Ich lese ihn von seinen Lippen. Er erzählt wieder und wieder seine "Geschichte der Vertreibung des Botanischen Gartens aus der Stadt". Keiner hört ihm zu. Sie laufen vorbei. Nur schnell fort zu Mathematik, Medizin, Physik, Chemie, den Lebenswissenschaften.
Ich bin lange bei Cousin Werner stehen geblieben. Von einer Grünphase zur nächsten. Rotes Männeken, grünes Männeken. Ich habe nicht gezählt, wie oft sie von Rot auf Grün und wieder auf Rot gesprungen sind. Arme gespreizt, Beine geschlossen. Busladungen von Fußgängern überqueren die breite Berliner Straße und die Gleise dazwischen. Die mit uns gewartet haben, gehen los, hinüber, ganze Massen kommen herüber, auf die Wadenwickel wartet und die er entlässt. Sie laufen vorüber. Sie sehen ihn vielleicht einen Augenblick. Dann haben sie dieses Phänomen aus den Augen verloren. Nicht mehr. Wie sie einen Laternenpfahl wahrnehmen, an dem sie vorübergehen, um nicht dagegen zu laufen. Dann musste ich doch eine Grünphase nehmen und gehen, um nicht aufzufallen.
Werner ist also verheiratet mit Violetta. Violetta – die Gewaltige, Gewalttätige. Violetta ist die Ehefrau. Dass Wadenwickel eine Frau haben soll? Noch immer. Obwohl er seit Jahren auf Platte macht im INF. Es ist ihre Sache. Nicht die Klinik wickelt seine Waden jeden Morgen neu, dass er saubere Binden um die Waden hat. Violetta besorgt das. Sie ist irgendeine der unzähligen Sachbearbeiterinnen in einem der unzähligen Ämter. Anonym. Unbeachtet. Inzwischen weiß ich, sie geht INF672. Mehr will ich nicht sagen. Ich sehe sie nie bei ihm. Nachspionieren wollte ich ihr dann doch nicht. Eine Walküre. Sie passt zu ihm. Auch für sie muss ich das Reden übernehmen. Violetta hat mich weggeschickt, als wäre ich ein Journalist. Oder einer vom Versorgungsamt.
Ich kann mich nicht entscheiden, rede ich von Wadenwickel oder Cousin Werner. Oder Maigret? Ganz nach Gefühl nenne ich ihn mal so, mal so. Ich kann nicht sagen, dass er als Cousin Werner mir näher wäre und als Wadenwickel fremder. Als Kommissar Maigret nichts weiter als eine literarische Gestalt. Maigret ist er ja nicht. Es ist nur der Spitzname unserer Schüler. Meiner Schüler. Meine Kollegen nehmen überhaupt nicht wahr, was ihre Schüler mit Werner an seiner Speaker‘s Corner treiben. Sie sind noch ahnungsloser als die Schüler.
Bei Sauwetter in einem knöchellangen, tarngrünen Lack-Armee-Poncho. In den Jahreszeiten des Übergangs mit Knickerbockers. Die Waden mit seiner blendend weißen Binde umwickelt. Weshalb auch immer. Offene Beine. Gegen Thrombose. Sie leuchten wie in Schwarz-Weiß-Filmen der Polizist, der den Verkehr regelt. Er trägt Gamaschen und die Arme in weißen Ärmelschonern. Diesen langen Lulatsch meine ich, der sich selbst spielt. Keiner kann so ungelenk mit dem Fahrrad hantieren. Oder die Umhängetasche dreimal um sich herumsausen lassen, wie dieser Schlacks, wenn er den Briefträger spielt. Die Urszene aller radelnden Komiker. Monsieur Hulot. Der Autor von Kommissar Maigret war Belgier und hat im unbesetzten Südfrankreich gelebt. Die besten Maigret hat Simenon zwischen 1933 und 1945 geschrieben. L‘Écluse No.1 etwa.
Werner ist eines schönen Tages ins Amt reinspaziert und ist Onkel Eugen an die Gurgel gegangen. Der Amtsleiter hat eine Anzeige gemacht wegen Hausfriedensbruch mit körperlichem Übergriff. Ein paar Tage danach hat Onkel Eugen die Anzeige wegen Körperverletzung zurückziehen lassen. Unter Verwandten tut man das nicht. Das Hausverbot besteht heute noch. Am liebsten hätte ihn die Amtsleitung aus dem gesamten INF verwiesen. Aber das Amt ist auch nicht mehr, was es mal war. Und die Landesregierung interessiert sich nicht für so einen Familienstreit. Außenseiter haben das Gespür, Außenseiter wahrzunehmen. Innenseitern fällt nichts auf.
Werner kam in die Geschlossene. "Kann von Glück sagen, dass wir die Psychiatrie nicht ins INF geholt haben!" Lästert Onkel Eugen. Er bleibt ganz ruhig, wenn er davon erzählt. Ich spüre, wie es in ihm zittert.Kapitel 14: HühnersteinHühner bekommen einen Stein ins Gehege gelegt, damit sie sich ihre Schnäbel daran wetzen. Das Huhn heißt in der lokalen Mundart Hinkel. In der Einzahl wie in der Mehrzahl. Wenn wir auf das Gewann Hühnerstein zu sprechen kommen, redet Onkel Eugen immer vom Hinkelstein. Was noch mehr für Verwirrung sorgt.
Einen Wetzstein kenne ich aus ersten Erinnerungen an alte Männer und Frauen, die Sensen und Sicheln benutzten, um eine Wiese zu schneiden, ein kleines Stückchen Grasland hinterm Haus. Wir Kinder durften dann das geschnittene Gras zusammenlesen. Wir mussten Acht geben, dass wir dabei nicht drauftraten. Sonst würde es anfangen zu gären und wäre verdorben. Da ich höchste Acht gab, durfte ich zwei, drei Hände voll Gras an die Hasen verfüttern. Der große Rest kam an ein trockenes Plätzchen unter einem Dach neben den Hasenställen. Der Vorrat reichte für acht Tage. Kein Kind durfte sich da freihändig bedienen und die Hasen füttern. Weil ein Kind nicht weiß, wann ein Hase Hunger hat.
Werner hat seinen Aufenthalt im INF immer wieder gewechselt. Nicht, dass er geflüchtet wäre. Eher wie ein Wachmann machte er seinen Kontrollgang übers Gelände. Notgedrungen steht er jetzt an der Ampel und redet dem Autoverkehr ins Gewissen.
Die Not ist der Bau des Auditorium Maximum. Einen Großen Hörsaal für alle hatte die Universität in ihrer sechs Jahrhunderte langen Geschichte noch nie. Das Auditorium ist ein Geschenk wie das Mathematikon. Von demselben geschenkt. Dieser größte von allen Hörsälen behebt eine innere Not. Er befriedigt das Bedürfnis nach Wachstum und Größe. Seit der Blüte des AudiMax in Berlin sind zwei Generationen von Professoren und Studierenden in die Einrichtungen der Hochschulen hinein- und wieder hinausgewandert. Der heutigen Generation der Lehrenden sitzt nicht mehr der Schreck vor den rebellierenden Studierenden in den Knochen. Jetzt erinnert sich bestenfalls ein Historiker für Nachkriegsgeschichte daran. Das AudiMax ist nicht von einer VW-Tochter gesponsert. Es ist einfach nur das Kürzel für den vielsilbigen Zungenbrecher Auditorium Maximum. Patienten werden den Hörsaal niemals von innen zu sehen kriegen. Seine Adresse wird wohl INF200 sein. Obwohl es auf dem Platz des alten Mathematischen Instituts, INF288, errichtet wird. Die überzählige 88 wird auf eine Doppelnull runtergerechnet. Eine 200 ist sehr viel eleganter und lässt sich leichter merken. Das AudiMax ist inzwischen der zweite Fall einer Überbauung eines bereits baulich genutzten Stücks eines ursprünglich langwirtschaftlich genutzten Ackers. Das alte Mathematische Institut wird platt gemacht. Archäologisch betrachtet bedeutet es die dritte Kultivierung des Erdbodens. Dort, im Schutz seiner wuchernden Hecken, hatte Werner viele Jahre sein Versteck.
Die nächsten Wochen verbringe ich mit einer größeren Zahngeschichte. Bis dreimal die Woche bin ich einbestellt. Seit Jahren komme ich auf dem Weg ins Kolleg am Seitentrakt der Kopfklinik vorbei. Ich mache langsam oder bleibe sogar stehen und schaue neugierig in die Fenster, wenn die Studierenden der Zahnmedizin sich gegenseitig die Zähne behandeln. Auf die Idee hat mich Violetta gebracht. Die ihren Werner dorthin schickt. Sie hat seit Jahren ihre liebe Not mit ihm. Und keinerlei Liebe nötig.
Angefangen hat Werners Ruin mit einem seiner Besuche bei Onkel Eugen im Amt. Doch so kurz und knapp, wie ich es geschildert habe, ist es dann doch nicht abgelaufen. Es ist nur die offizielle Version des Bauamts. Es war nicht der Anfang. Nur der erste Ausbruch. Werner lag nichts daran, sein Gesicht zu wahren. Um sowas hat er sich nie gekümmert.
Irgendwann hat er angefangen zu spinnen. Wann genau, kann Violetta nicht sagen. Er hat sich geweigert, Rechnungen zu bezahlen. Die Rechnungen der Stadtwerke. Der Telekom. Er hat die Einzugsermächtigungen widerrufen. Wasser, Strom, Fernwärme. Alle Nebenkosten. Er verweigerte der Müllabfuhr, die Tonnen zu leeren. Die Nachbarn würden seinen Strom anzapfen, sein Wasser und seine Wärme in ihre Häuser umleiten. Zuletzt hat er die ganze Straße und dann die halbe Siedlung beschuldigt. Er hat manchmal bei den Nachbarn geklingelt und es ihnen vorgehalten.
Violetta ist gar nichts anderes übrig geblieben, als alles wieder zurechtzurücken. Hinterher geräumt wie einem Kind. Und die offenen Rechnungen bezahlt.
Dann hat er das Haus für immer verlassen. Er gehe an die frische Luft. Für die Luft soll ihm mal einer eine Rechnung schicken. Und dass er ja überhaupt nicht zu Hause sei. Darum könne ihn keiner mehr abkassieren. Empfänger unbekannt. So habe Werner kreuz und quer gedacht.
Da hat sie ihn einweisen lassen.
Violetta bedeutet die Gewaltige. Sie leistet Gewaltiges. Ich habe sie in meinem wortspielenden Leichtsinn die Gewalttätige genannt. Was sie mir krumm genommen hat. Weiß nicht, welcher Teufel mich da geritten hat. Weil sie doch Gewaltiges leiste, also täte. Damit habe ich versucht mich zu rechtfertigen. Aber mich nur noch mehr reingeritten. Sie hat es mir krumm genommen und mich für dumm gehalten. Immerhin weiß sie, dass ich es gut meine.
Als Werner entlassen wurde, hat er es nicht einen einzigen Tag daheim ausgehalten. Er machte sich gleich wieder auf und davon. Die erste Nacht schon hat er auf dem Campus in seinem Versteck verbracht.
Es dauerte gerade mal vier Wochen, dann hatte er wieder einen Schub. Das Bauen muss doch einmal ein Ende haben. Die Universität ist sechshundert Jahre alt. Sie könnte längst fertig sein und endlich das Bauen sein lassen. Die Natur sprießt aus der Erde, wächst, blüht, ihre Früchte reifen im Herbst. Dann wird geerntet und die Pflanzen haben ihre Ruh‘. Alles, was über’s Jahr wächst und gedeiht, will im Winter seine Ruhe haben und sich im Erdboden verkriechen. Damit hat er sein Predigen wieder aufgenommen.
Eines Tages war er ganz verschwunden. Vom Erdboden verschluckt. Violetta hat nach ihm gesucht. Den ganzen Campus abgegrast. Kein Werner. Anfangs suchten wir das Ufer ab. Vielleicht war er ins Wasser gegangen. Man meldet sowas nicht gleich bei den Behörden. Sie wollte erst alles probieren. Violetta ist dann mit dem Rad raus in die Felder. Acht Tage haben wir gesucht. Weit draußen, hinter dem Sportzentrum mit dem Kick-Campus haben wir ihn entdeckt.
Eine große Hühnerschar war bei ihm. Und Gänse. Und Ziegen. Schafe. Sogar Schweine. Den ganzen Hühnerstein hatte er eingezäunt. Badewannen mit Wasser standen verteilt. Auch Violetta konnte nicht rauskriegen, woher er den ganzen Kram hatte. Der Gemüse-Grieser vom Saubad nebenan hat ihm den Wasserschlauch geliehen und an seine Berieselungsanlage angeschlossen. Die Sau lag hinter einem festen Gatter. Sie hätte ihm die andern Tiere gefressen. In einer Ecke im Pferch hat er ihr eine Suhle eingerichtet. Zu fressen hatte das Federvieh genug, die Ziegen und Schafe sind genügsam und eine Sau frisst alles. Sie hat in diesem Sommer Ferkel geworfen. Ein paar offene Schuppen hatte er aufgestellt. Niedere Verschläge, nach allen Seiten offen. Höhere und ganz flache. Wohin sie sich flüchten konnten. Ein Dach über dem Kopf.
Ein Rabe war bei ihm. Hasen hat er noch gehalten. Er hat sie nicht in Verschlägen gehalten. Stallhasen ohne Stall. Sie hoppelten frei zwischen den andern Tieren herum. Es waren keine Feldhasen. Feldhasen lassen sich nicht einfangen. Sie müssen geschossen werden, um einen zu bekommen. Violetta hat nicht rausgekriegt, von wem er die Tiere hatte. Ein Bart war ihm gewachsen. Jetzt rasiert sie ihn wieder und schneidet ihm die Haare. Violetta hat ihren Werner rechtzeitig vom Feld runter und in die Klinik gebracht. Wegen seiner offenen Beine.
Mit den Kindern war ich ein paar Mal nach den Hühnern schauen gegangen. Sie radeln gern und lieben Hühner. Generell die Tiere, wenn sie kleiner sind als sie selbst.
Vor dem Winter kam schweres Gerät und hat seine Baracke platt gemacht. Und seine Tiere waren auf und davon. Auf seinen Feldern wurden Berge von Mutterboden abgekippt. Erdaushub für die neuen Wohnheime. Es war das Jahr, als die Hochhäuser mit zehn Stockwerken plattgemacht und durch fünfstöckige Gebäude ersetzt wurden. Unser Kolleg befindet sich mitten drin, nichts als Staub und Lärm. Presslufthämmer und Abrissbirne. Manchmal ist ein Steinbrocken durch ein Fenster geschlagen. In diesen zwei Semestern sind keine Studierenden durchgefallen.
Einen Sommer lang hat Werner sich auf dem Hühnerstein aufgehalten. Jetzt steht er wieder an der Ecke und predigt den Autos. Es scheint ihn nicht zu stören, dass ich ihm von den Lippen lese. Mir ist es recht, und Violetta ist es auch lieber, dass er auf niemanden reagiert. Alle gehen schnurstracks an ihm vorüber. Er steht an seiner Speaker‘s Corner und predigt dem Verkehr.
Werner wollte den Hühnerstein blockieren. Dass die Neue Sporthalle nicht gebaut würde. Eine Halle mit einem unvorstellbaren Fassungsvermögen, wie sie unsere kleine Stadt bisher nicht kennt. Werner hat einen unfassbaren Fehler gemacht. Das Gewann war für den Neuen Botanischen Garten geplant.Kapitel 15: SonnenaufgangEin Sammler teurer Uhren bin ich nicht.
Ich verfolge den Aufgang der Sonne und führe Buch. Seit dem 4. Januar notiere ich Morgen für Morgen die Zeit ihres Aufgangs. Und abends ihren Untergang. Hier eine Minute früher, da eine Minute später. Manchmal sind es auch zwei. So werden die Tage länger. Selten erscheint die Sonne an zwei Tagen zur gleichen Minute. Noch seltener geht sie an zwei Abenden zur gleichen Zeit unter. Im Hochsommer kehrt sich das Schauspiel um. Dass ich auch die Umkehr im Protokoll festhalten würde, glaubte ich eher nicht. Es wäre vertane Zeit. Die Tage werden Tag für Tag kürzer. Ich sollte das Tageslicht besser nutzen. Und protokolliere weiter, wie nicht ganz bei Trost.
Auch die Sonne spielt an manchen Tagen verrückt. Letztes Jahr etwa ist sie vom 12. bis 22. Juni um 5.18 Uhr aufgegangen. Laut Protokoll volle zehn Tage hintereinander zur gleichen Zeit. Ich schwöre es! Mir ist die Stoppuhr nicht aus der Hand gerutscht. Habe mir die Liste der Aufzeichnungen der Sonnenaufgänge wieder und wieder angeschaut. So steht es in meinen Aufzeichnungen. Zehn Morgen lang steht da 5.18 Uhr.
Als eine weitere Stichprobe habe ich den 4. Februar genommen. Den 4. Februar in diesem Jahr und im letzten Jahr - Sonnenaufgang um 7.53 Uhr. Beide Male. Hätte von der Sonne eher erwartet, dass sie es nicht so uhrgenau macht, Jahr für Jahr seit Millionen von Jahren. Wie kann ich die Daten der 365 Sonnenaufgänge eines Jahres in Worte fassen?
Ich bin ein Frühaufsteher. Nicht, weil ich vor der Arbeit noch würde etwas Frühsport treiben wollen. Einfach nur so. Sechs Uhr wäre meine Zeit, die Stunde, die zu mir passt. Also warte ich von Weihnachten an, bis es 6 Uhr und hell ist. Kurz vor Ende März wäre es fast soweit. Am 29., einem Freitag, geht die Sonne um 6.09 Uhr auf. Fast hätte ich es geschafft! Meinem Zeitgefühl nach müsste es nächsten Montag oder Dienstag um 6 Uhr so weit sein. Endlich! Und ein Grund zum Feiern. Ich würde am Fenster stehen und nach der Sonne schauen.
Pustekuchen!
In der Nacht zum Samstag, vom 29. auf den 30. März, springt die Uhr zwei Stunden nach Mitternacht um eine Stunde vorwärts. Und die Sonne merkt es eine volle Stunde lang nicht. Wenn sie erscheint, zeigen die Uhren bereits 7 Uhr. Aus der Traum vom Sechs-Uhr-Tee. Nichts war es mit dem Aufstehen um 6 Uhr. April, April!
Aber verschoben ist nicht aufgehoben.
Die Sonne Punkt sechs Uhr zu sehen kriege ich am 3. Mai. Woraus ich schließe, dass die Sonne vier Wochen braucht, um eine Stunde voranzukommen. Also um einen Tag um eine Stunde länger oder kürzer zu machen. Der Mensch stellt in ein paar Sekündchen die Zeiger seiner Uhr ein Stündchen vor. Und wieder zurück.
Zu warten lohnt sich. Nicht immer, aber manchmal schon.
Um 6 Uhr die Sonne aufgehen zu sehen kriege ich dann wieder am 4. August. Dass es vor und nach 6 Uhr auch hell oder dunkel, Tag oder Nacht sein kann, dessen bin ich mir bewusst.
Ohne eine Zeitmessung mit der Uhr würden wir noch immer mit den Hühnern aufstehen, wie Oma. Bis dahin sind wohl alle Menschen erst aufgestanden, wenn auch die Sonne dazu bereit war.
Ich mache mir Gedanken über die Tagundnachtgleichen. Und bin besorgt. Die Äquinoktien kann es nach dem Lauf der Sonne nur zweimal im Jahr geben. Das haben die Ägypter und die Perser beobachtet. Die Europäer der Alten und Neuen Welt haben es übernommen und in ihre Kalender den 21. März und den 21. September eingetragen. Wir beginnen das Frühjahr und den Herbst um dieses Datum herum.
Ich nehme aber nicht das Datum, sondern eine Uhrzeit, um zu verdeutlichen, was meine Sorge ist. Dafür muss ich für einen Moment versuchen, von meiner Sechs-Uhr-Manie loszukommen, und nehme 7 Uhr als Maßstab zum Vergleich.
Am 5. März wird es um 7 Uhr Tag. Und dann nochmal am 2. April. Und das dritte Mal am 15. September. Wir Menschen haben also drei Mal zur gleichen Uhrzeit einen Sonnenaufgang in einem Jahr. Jedoch die Sonne kennt nur zwei Tag- und Nachtgleichen.
Was fühlt sich die Sonne, wenn sie sich derart behandelt sieht?
Der Zeitpunkt 6 Uhr ist mir heilig. Wenn ich um 6 Uhr bei Tageslicht aufstehen kann, bin ich ohne allen Stress um sieben in meiner Cafeteria und beginne gut gelaunt den Tag.
Gestern hatten wir die Zeitumstellung. Ich ignoriere sie einfach. Meine Funkuhren zeigen mir die Zeit, an die ich mich zu halten habe. Egal, auf welche meiner Uhren ich nach der Zeit sehe, es ist 6.30 Uhr. Ich stehe um 6.30 Uhr auf und verschwende keinen Gedanken daran, dass es in Wirklichkeit 5.30 Uhr ist. Ich sehe keinen Sinn darin, mich dagegen zu wehren. Aus dem natürlichen Wechsel von Tag und Nacht bin ich längst herausgewachsen.Kapitel 16: AltneudorfAls Onkel Eugen geboren wurde, bekam Thomas Bernhard Tuberkulose. Und Georges Simenon schrieb Mon ami Maigret.
Wann war das?
Als die Bundesrepublik gegründet wurde. Und die DDR.
Geholfen hat es mir nicht. Während dem Studium nicht. Und im mündlichen Examen auch nicht. Der Professor hat es nicht gewusst. Und der Protokollant auch nicht. Aber die Stimmung hat es gelockert. Und gelacht wurde. Onkel Eugen, Thomas Bernhard und Georges Simenon. Zusammen in einem Paket.
Ein guter Historiker muss eine lange Historie interessant und in aller gebotenen Kürze erzählen können. Das erwarte ich von mir. Nicht nur die Fakten zählen. Betrachtungen über Sachverhalte stören vielleicht. Aber was habe ich anderes als meine Gedanken und Meinungen.
Ich war am Ende angekommen. Die Bebauung unserer Felder, mit der ich ohne Onkel Eugen niemals klar gekommen wäre. Eugen und Heidrun wären eine andere Geschichte. Cousin Werner Wadenwickler? Werner! Kein lebendigeres Beispiel hätte ich finden können für die Verrückten unserer Stadt als ihn. Dankbar müsste ich ihm sein. Durch ihn habe ich Violetta kennengelernt. Und allen Verrückten danken, die mich ihn haben finden lassen.
Der Winter ist noch draufgegangen. Weihnachten im Flexer Wald-Hotel. Das Wintersemester hat pünktlich geendet. Ende Februar ist Birgit mit den Kindern und dem Hund noch einmal zum Skilaufen nach Ober-Flex. Das ist die Ski-Station vom Wald-Hotel auf 2.200 Meter Höhe.
Ich hatte nochmal meine Gelegenheit bekommen für meine Verrücktheiten.
Am 16. März hat die Universität erbarmungslos dichtgemacht. Ausgeschlossen standen wir vor den Türen. Drückten unsere Stirn gegen die Scheiben, um reinzuschauen. Die Lichter blieben aus.
Dieses Fleckchen Erde, das wir brauchen zum Leben, wir waren zufrieden damit und fühlten uns geborgen. Es hat unsere Leben erträglich gemacht. Und freundlicher zueinander. Jeden von uns. Vor die Tür gesetzt! Futsch! Worauf wir uns lange Zeit verlassen haben.
Wir trödelten vor dem Gebäude. Jeder für sich. Kein Wort zum andern. Nicht mal angeschaut. Kein Auge in Auge. Jeder trödelte für sich. Verdünnisieren. Unmerklich wurden wir weniger. Allmählich verliefen wir uns. So mit sich selbst beschäftigt. Mit der Angst, wohin mit mir. Ich habe das kleine Café nebenan offen gefunden und einen türkischen Mokka getrunken. Das letzte Mal für lange Zeit.
So kurz vor dem Ende meiner Geschichte wird mir der Boden unter den Füßen weggezogen. Die lebendige Ruhe der Cafeteria genommen. Wer verweigert mir, dass ich von meinen Verrückten berichte?
Ich sollte es nicht persönlich nehmen! Sondern auf die leichte Schulter.
Ich muss doch nur noch hier und da ein wenig biegen, dort wieder geraderücken, was zu krumm ist; ein wenig schleifen, feilen, polieren. Wohin mit mir? Um mit Ruhe noch einmal alles zu überdenken. Ich konnte nur heim in die eigenen vier Wände, die leer standen. Unbelebt wie die ganze Stadt.
Von diesem Tag an herrschte Totenstille. Ausgestorben die Straßen und Plätze. Ungenutzt. Nutzlos. Unter der Woche herrschte eine Ruhe wie Sonntagnachmittags, wenn alle ihr Verdauungsschläfchen halten. Kein Leben in der Hauptstraße. Keine Blaumänner gingen Streife. Die Gebäude standen. Ungenutzt. Türen und Fenster blieben geschlossen. Wo ist diese Armada von Hausmeistern, die die Institute der Hochschule frühmorgens aufschließen? Sie sind die ersten Lebenszeichen der erwachenden Stadt. Die Küster der Kirchen? Keinen sah ich kommen oder gehen. Die Kirchturm-Uhren schlagen die Viertelstunden. Aber die Glocken läuten zu keinem Gottesdienst. Diese ganze Altstadt ist tot. Die den letzten Krieg verschont geblieben war. Was soll sie, wenn kein Mensch kommt um sie anzuschauen! Ein US-amerikanischer Präsident hat eine Bombe entwickeln lassen, die nur die Menschen tötet und die Häuser unbeschädigt stehen lässt. Der Mensch sei der Feind. Ein Haus macht keinen Krieg.
Die Schulen bleiben geschlossen. Die Kinder haben gejubelt in der Schweiz. Als ich es ihnen am Telefon verkündet habe. Verlängerte Ferien über den Karneval hinaus. Fassenacht sagt man wohl auf Schwyzerdütsch. Ja, als die Uhren sich umstellten, war ich noch immer für mich. Was bleibt mir zu sagen bei meinem Abgesang auf die Menschen?
Von wegen Schall und Rauch! Namen sind dauerhafter als Steine. Die nördlichen Stadtteile jenseits des Flusses heißen Neudorf und Altdorf. Neudorf hat sich zwischen Altdorf und die Stadt gedrängt. Neudorf grenzt an den Fluss. Neudorf hat einen Ruder-Club.
Neudorf war von Anfang an städtischer. Näher bei der Stadt. Altdorf pflegt die Traditionen. Die heiligste Tradition ist der Hammeltanz.
Neudorf wurde von Städtern gebaut. Den Boden gab ihnen Altdorf. Neudorf ist verbaut. Von der Stadt her und von Altdorf her. Auch Altdörfler wollten weg ins Neudorf. Es gibt nur noch verdichtetes Bauen. Auf dem Garten beim Haus steht jetzt ein zweites Haus.
Altdorf besitzt heute noch Felder. Vom Berg herunter gesehen glänzen die Folienabdeckungen und Glashäuser der Gartenbaubetriebe im Sonnenschein. Erdbeeren und Spargel. Obst und Gemüse. Muttererde.
Grund und Boden über dem Fluss gehörte vor hundert Jahren noch nicht der Stadt. Das liegt an der Historie. Historie ist immer die Geschichte von Gewalt. Der Fluss war Jahrhunderte lang die Grenze zwischen dem einen Kurfürsten und dem anderen. Der eine ein katholischer Bischof, der andere weltlicher Fürst. Die Vorsilbe Kur bedeutet Wahl, wie die Kür beim Turnen oder Eiskunstlauf. Das Kollegium der Kurfürsten im Reich wählte den König. Dem König gehörte alles Land, Wasser und Luft. Und alles, was im Land, im Wasser und in der Luft lebte. Das ist heute noch so. Was der Staat braucht, nimmt er sich. Und geht bis zur Enteignung.
Versteht sich von selbst, dass der Staat anders gegliedert ist als zu Kaisers Zeiten. Weniger kompliziert. Weniger oft gefaltet. Aber umso straffer organisiert: Bund, Länder und Kommunen. Sie handeln zum Wohl aller. Das funktioniert am besten, wenn alle nicht mitzureden haben.
So funktioniert auch der Hammeltanz. Den tanzen eine Handvoll Familien. Nach jeder Musik scheidet ein Paar aus. Das letzte Pärchen hat den Preis gewonnen. Einen Hammel! Die Verlierer neiden ihn dem Siegerpärchen. Trotzdem! Von da her kommt der Neidhammel!
Der Mai war vergangenes Jahr ohne Wonnen. Die Luft war frisch bis zur Kälte. Es regnete drei Wochen lang. Und am Ende hat Europa gewählt. Europa ist sauer auf seine Wähler. Weil sie gewählt haben, wie sie gewählt haben. Mit Wählern ist einfach kein Staat zu machen. Mal sehen, was der Mai uns diesmal bringt.
Festen Boden unter den Füßen braucht der Mensch. Sonst wäre er ein Engel. Den meisten Boden verbraucht der Mensch als Tourist. Sein Flugzeug braucht in Europa einen Airport, um zu starten. Und einen in Asien, Amerika oder Australien, um zu landen. Eine einfache Rollbahn genügt nicht. Es braucht den ganzen Aufwand eines Flughafens. Und sei er auch noch so klein.
Bergamo hat so einen kleinen Flughafen, Milan-Bergamo in der Breganza. Einen wie Frankfurt-Hahn im Hunsrück. Die Billigflieger starten und landen dort. Ein knappes Stündchen ist es bis Mailand. Monza liegt auf dem Weg dorthin. Im Parco di Monza haben wir mit Alessandro die Formel 1 besucht. Er wohnte früher im Mailänder Stadtteil San Siro. Bergamo, Milan, die Breganza habe ich bei Alessandros Verlobung kennen gelernt. Der Fahrer des Safety-Cars heißt Mailänder. Ist mir gerade so eingefallen.
Unsere Anfänge lagen im Kies. Eine doppelschlechte Lage. Ein Haufen Geröll und ein Ausläufer vom Galgenbuckel. Nah am Fluss, aber hoch genug, dass der Boden nicht überflutet wurde. Die Gedanken springen wie kleine Mädchen wenn sie Himmel und Hölle spielen. Sie versuchen, nicht auf den Strich zu treten, wenn sie hüpfen; hickeln heißt es hier.
Ich bin in Gedanken diesseits der Berliner Straße, die einmal über Darmstadt nach Frankfurt führte.
Ein sanfter, anhaltender Nieselregen tut immer gut. Nicht nur in den Hundstagen wie im letzten Sommer. Da hat er sehr gefehlt. Der feine, leise Sprühregen, der von den Blättern der Bäume und den Leitungen der Bahnen auf die Straßen und Radwege tröpfelt und in Schwaden vom heißen Asphalt gleich wieder aufsteigt.
Am Ende einer langen Debatte ruft Oberbürgermeister für unsere Stadt den Klimanotstand aus. Die Ziele zur Reduktion der Treibhausgase wurden verfehlt. Die Werte beziehen sich auf die Messungen der Stadt im Stadtkern. Und um den Kern herum.
Der Arbeitskreis Klimaschutz & Energie legt einen Antrag vor und die Fraktionen des Stadtrats stimmen einer Gebührenerhöhung der Stadtwerke für Energie und Mobilität zu. Bin ich noch immer nicht genug gestraft?
Es ist und bleibt ein Kreuz mit dem Neuen Campus. Wie komme ich da hinein und wieder heraus. Und zweitens: Wir brauchen beides, Spitzenforschung und Spitzengemüse. Die Felder sind zugewachsen, überwuchert von Gebäuden. Wo ein Haus steht, wächst kein Baum mehr. Ich denke an Onkel Eugen. Dem das Glück mit Heidrun zu gelingen scheint.Kapitel 17: SnookerAm Wochenende habe ich rund um die Uhr Snooker gesehen. Live und in Wiederholungen der High-Lights. Beim Snooker gibt es zwei Spieler und einen Unparteiischen. Drei um einen Tisch. Die Spieler begrüßen und verabschieden sich, indem sie die Ellbogen aneinander stoßen. Der Schiri trägt schon immer weiße Wollhandschuhe. Ohne Zuschauer herrscht Ruhe im Saal. Kein Handy stört mehr die Spieler in ihrer Konzentration. Ab und zu knallt ein Ball gegen die Bande. Niemand auf den Rängen, der Beifall klatscht. Keine Hand rührt sich bei einem Zauberstoß. Die wunderbarsten Stöße verlieren sich in der Stille. Der Sport ist kein Ereignis mehr. Statt Resultaten liefert er nur noch steigende Zahlen infizierter Profis.
Denn die Natur hat ein kleines Kügelchen über den Erdball gerollt. Sie greift ein und reguliert, wo der Mensch übertreibt. Mutter Natur will nicht, dass ihre Menschenkinder weitermachen wie bisher. Damit diese zur Besinnung kommen, hat sie einen neuen Virus entwickelt.
Denn die Natur hat ein kleines Kügelchen über den Erdball gerollt. Sie greift ein und reguliert, wo der Mensch übertreibt. Mutter Natur will nicht, dass ihre Menschenkinder weitermachen wie bisher. Damit diese zur Besinnung kommen, hat sie sich einen neuen Virus entwickelt. Und sich den Sportler ausgeguckt, der ihr den Virus verbreitet. Sie hätte keinen talentierteren Überträger finden können. Sport wird noch globaler ausgeübt als die Fortpflanzung. Schon Kinder gehen ins Turnen. Und Senioren noch lange nach ihrer Fruchtbarkeit. Der Virus ist keine Strafaktion. Mehr wie ein Unwetter. Ein natürliches Sedativ, dass der Mensch zur Ruhe kommt. Statt andauernd herumzuturnen oder davonzulaufen. Der Mensch hat seinen Geist zu entwickeln, nicht dicke Muskeln aufzubauen und sich schnelle Beine zu machen. Für Kraft und Geschwindigkeit hat sie sich ausreichend mit Tieren versorgt. Die Natur will den Sportler nicht als höchstes Wesen. Das geht ihr gegen den Geist.
Darum inszeniert sie uns gerade das größte Event der Naturgeschichte. Die Weltpolitiker fallen drauf herein und verbieten global allen Menschen alles, was das Leben lebenswert macht. Kein Shopping, keine Vergnügungen, kein Ausgehen, kein dolce vita, keine Öffentlichkeit. Die Kinder lernen, dass Oma und Opa sterben, wenn sie ihnen einen Kuss geben. Damit sie nicht zu Mördern ihrer Großeltern werden, müssen sie daheim bleiben. Sie haben nichts angestellt, und bekommen Hausarrest.
Politiker und Mediziner arbeiten dabei Hand in Hand. Die einen sind Spezialisten für Erkrankungen, die anderen verstehen sich auf Öffentlichkeit. So haben sie sich die Gefangenschaft für alle ausgedacht und sie mit dem schönen Namen Quarantäne maskiert.
Warum Quarantäne für Alle, stellt mir Violetta klar und deutlich vor Augen. Violetta ist die Frau, die sich um Cousin Werner Wadenwickler kümmert.
Violetta ist Mitarbeiterin der Abteilung Medizinische Statistik INF672. Eher zufällig sind wir uns vor der Zentral-Mensa INF304 über den Weg gelaufen. Sie wollte nur nach Werner schauen, ob mit ihm alles im Lot wäre. Dann haben wir uns wider alles Verbot einen Biertisch vom Stapel genommen und aufgestellt. Als wir ihn stabil hatten und er nicht mehr wackelte, hat sich jeder einen der draußen vergessenen Stühle beigezogen und sich gesetzt.
Ein Bier-Garten-Tisch ist 2,20 Meter lang und achtzig Zentimeter breit. Wir setzten uns aber nicht an die langen Enden und jeder für sich, dass wir den Zwei-Meter-Abstand hätten. Sondern wir haben in der Mitte der langen Tafel nebeneinander Platz genommen. So reden wir in die gleiche Richtung und nicht einander ins Gesicht.
Violetta hat sofort mit diesem Korridor angefangen, in dem wir derzeit unser Leben verbringen müssen. Sie hat sich alle Mühe gegeben, mir dieses Modell der eingeschränkten Mobilität verständlich zu machen.
Demnach ist das Leben derzeit eine algebraische Funktion mit der Grundkonstanten 40.000 Betten und einer Variablen, nämlich der Entfernung von zu Hause. Das Verhältnis zwischen unseren täglichen Wegstrecken und den 40.000 Betten, die auf den Intensiv-Stationen der Kliniken bereitstehen, bestimmt nun die Maße dieses Korridors.
Die Breite des Korridors sind die 40.000 Intensiv-Betten, die uns zur Verfügung stehen. Die Länge des Korridors wäre die Zeit, die gebraucht wird, bis alle 80 Millionen Einwohner unseres Landes in diesen Korridor hineingebracht wären.
Unser Land, sagte sie, unser Land hat 80 Millionen Einwohner. Das ist eine 8 mit 7 Nullen. Dann hat Violetta ein Stück Papier aus der Tasche gezogen, auseinander gefaltet und sich meinen Bleistift geben lassen.
Das ist die x-Achse, sagte sie, und zog einen horizontalen Strich quer über das Blatt, mit einem X links. Darüber schreibt sie wieselflink die Namen Wuhan, Madrid, Milano, Hamburg und München, beide mit ihren Autokennzeichen HH und M, dann die Wörter Wohnort und Wohnung. So in etwa:
Wuhan – Madrid/Milano – HH/M – Wohnort – Wohnung
Unter jedes Namenwort schreibt sie eine Zahl – von 100 bis 0,1 mit dem Prozentzeichen % dahinter.
Diese erste Linie kennzeichnet sie als X1. Großes X mit kleiner 1.
Vertikal und unter jeden Namen setzt sie einen Punkt. Und zwar in sinkender Reigenfolge je nach Größe der Prozente unter den Namen. Zwischen den vier oberen Werten 100 bis 12,5 und dem untersten Wert 0,1 zieht sie einen Querstrich. Das ist die Achse X2. Und zuletzt noch einen Strich unter dem niedrigsten Wert 0,1. Den nennt sie Null-Basis-Linie.
So in etwa sieht das Ganze jetzt aus:
Wuhan – Madrid/Milano – HH/M – Wohnort – Wohnung
X1 100% 50% 25% 12,5% 0,1%
·
§
o
*
X2______________________________________________________
o
X3_______________________________________________________
X1 = Infektionsquote je Aufenthaltsort für 1 Woche
X2 = Maximale vorhandene Intensiv-Bettenzahl = 40.000
X3 = Ideal-Basis = 0,0% Infektionen
Als Violetta mit ihrer Skizze fertig ist, fasst sie alles nochmal in Worte.
Ziel ist, sagt sie, Orte zu finden, die nicht mehr als 40.000 Schwer-Erkrankungen mit sich bringen. Entsprechend der vorhandenen Bettenzahl auf Intensiv-Stationen der Kliniken bundesweit.
Benutz mal deine Stirn, sagt sie und tippt sich an die eigene, und stell dir vor, alle 80 Millionen Einwohner fliegen für eine Woche nach Wuhan. Wuhan ist in China. Nein, egal, ob als Tourist oder im Business. Wenn sie nach acht Tagen wieder heimfliegen, haben alle den Covid19 als Souvenir mit im Gepäck. Bei Gepäck macht sie diese Zwei-Finger-Bewegung für Anführungszeichen oben und unten.
Wir müssen davon ausgehen, sagt sie, dass alle sich angesteckt haben. Aber können auch davon ausgehen, dass nur die Hälfte von ihnen erkrankt, also Symptome zeigt wie Fieber, Kopfweh, Husten, Atemnot und andere. Damit hätten wir bei 80 Millionen Wuhan-Heimkehrern mit 40 Millionen Covid19 Kranken zu rechnen. Von diesen 40 Millionen wiederum verläuft aber nur bei jedem Zweiten die Erkrankung derart gravierend, dass er in die nächste Klinik mit Intensiv-Station eingeliefert werden muss. Also brauchen wir, bei 80 Millionen Wuhan-Heimkehrer 20 Millionen Intensiv-Bettenplätze für die Beobachtung, Behandlung und Beatmung.
Kurz gesagt: Bei 100-prozentiger Infizierung, brauchen wir 20 Millionen Intensiv-Betten. Wir haben aber nur 40.000 Intensiv-Betten bundesweit.
Die 40.000 Intensiv-Betten sind die erste Konstante. Die Bettenzahl lässt sich nicht auf die Schnelle erhöhen. Weil an jedem Bett ein Rattenschwanz von hochtechnischen Geräten hängt samt Personal, das mit dem High-Tech-Equipment umgehen können muss. Die zweite Konstante sind die unveränderlichen 80 Millionen. Wohin mit denen? Daran lässt sich drehen. Also die Aufenthalte der 80 Millionen sind unsere Variable!
Wir lassen die mal nicht bis nach Asien fliegen! Sie sollen in Europa bleiben! Und schauen, was passiert.
Nehmen wir Spanien und Italien. Madrid und Mailand sind gute Beispiele. Ist ja auch hübsch dort. Nehmen wir an, dass wir wieder für acht Tage alle 80 Millionen Einwohner nach Mailand verreisen lassen.
Nach unserem Rechenmodell kommen dann nur noch 40 Millionen infiziert heim, von denen die Hälfte, also 20 Millionen, auch erkranken, von denen wiederum nur die Hälfte schwer, also 10 Millionen. Für diese 10 Millionen brauchen wir 10 Millionen Intensiv-Betten. Wir haben aber nur 40.000. Also mit Spanien und Italien ist’s auch nichts. Immerhin sehen die Zahlen schon etwas besser aus!
Wir müssen also schauen, dass wir für die Leutchen ein Reiseziel finden, wohin wir sie reisen lassen können, sodass nur noch 40.000 von allen 80 Millionen derart ernsthaft krank werden, dass sie auf die Intensiv-Station eingeliefert werden müssen.
Offensichtlich ist es wichtig, dass die Leutchen nicht so weit weg von daheim verreisen. Verkürzen wir ihre Reisestrecke noch ein wenig. Unser Land hat doch auch schöne Gegenden!
Hamburg vielleicht, wen es ans Meer zieht. Oder München, wer die Berge lieber mag. Rechnen wir jetzt mal Hamburg und München durch!
Wenn alle 80 Millionen für 8 Tage nach Hamburg fahren, dann kommt nur ein Viertel mit einer Infektion zurück. Von diesen 20 Millionen erkrankt wieder nur die Hälfte. Von diesen 10 Millionen Erkrankten benötigen 5 Millionen ein Intensiv-Bett. Wenn wir also freies Reisen innerhalb unseres Landes freizügig erlauben, brauchten wir 5 Millionen Intensiv-Betten, um alle beobachten, behandeln und beatmen zu können.
Du siehst, die Leine ist noch immer zu lang gelassen. Halten wir sie also noch was kürzer.
Jeder soll an seinem Wohnort bleiben. Egal ob Millionen-Stadt, Groß- oder Kleinstadt, oder ein Dorf. Jeder soll bleiben, wo er gemeldet ist. Dann errechnen sich folgende Werte.
Nur noch ein Achtel von 80 Millionen wird sich infizieren. Von diesen 10 Millionen Infizierten werden 5 Millionen Symptome einer Erkrankung zeigen, davon wiederum die Hälfte Anzeichen einer ernsthaften Erkrankung. Damit sind wir bei 2,5 Millionen Schwer-Erkrankten. Aber auch 2,5 Millionen Intensiv-Betten haben wir nicht!
Einen Versuch haben wir noch: Bleibt zu Haus!
Wenn alle 80 Millionen zu Hause bleiben, wird sich nur 0,1 Prozent mit Covid19 infizieren. Das sind 1 Promille, also einer von Tausend. Es bestehen ja keinerlei Außenkontakte mehr. Violetta patscht in die Hände.
Rechnen wir es durch!
Wenn wir richtig rechnen, bleiben uns bei 80 Millionen Nesthocker-Haushalten dennoch 80.000 Infizierte, davon werden 40.000 erkranken und 20.000 schwerst.
Jetzt hebt Violetta mahnend triumphierend den Zeigefinger – also brauchen wir nur die Hälfte der vorhandenen Intensiv-Betten mit Beobachtung, Behandlung und Beatmung.
Die restlichen 20.000 Intensiv-Betten können wir uns in der Rückhand freihalten. Oder wir verwenden sie kurzerhand für Schwerst-Covid19-Erkrankte aus Italien, Spanien, Frankreich, oder von woher auch immer.
Nach getaner Arbeit strahlt Violetta und patscht sich den Staub von den Händen. Patsch! Patsch! Patsch!
Bleibt daheim! – ist also das gebotene Mittel, mit dem wir diesen verflixten Covid19-Teufel schnellstens in den Griff kriegen. Patsch! Patsch! – Patsch! Patsch! Patsch!
Eine andere Lösung habt ihr nicht?
Wozu das denn? Wenn du unbedingt willst! Abwarten und Tee trinken. Bis achtzig von hundert infiziert sind. Dann beruhigt sich das Szenario von selbst. Bei achtzig von hundert tendiert die Quote der Neuinfizierungen automatisch gegen null.
Achtzig von hundert? Das wären 64 Millionen? Vierundsechzig Millionen wären am Ende infiziert! Und die restlichen 16 Millionen?
Sind davongekommen. Glück gehabt!
Und wie viele von den 64 Millionen sind bereits infiziert?
Woher soll ich das wissen.
Wir packen uns. Bier-Tisch und Stühle lassen wir stehen.
Violetta schaut kurz in ihre Abteilung Medizinische Statistik INF672 rein. Ich beneide sie darum! Mir ist der Zutritt ins Kolleg untersagt. Die Turnstunden kann ich verschmerzen. Die Studierenden aus der ganzen Welt fehlen mir sehr. Ich darf nicht mal kurz ins Kolleg, um auf die Toilette. Die ID-Card, mit der sich die Türen öffnen ließen, würde mich verraten. Was sind wir eine brave Generation. Gehorsam wie meine Großeltern zu Adenauers Zeiten.
Ich gehe in die unbebauten Felder die Feldwege entlang. Die Temperaturen steigen. Die Pflanzen treiben. Die Bäume beginnen ihre Blüte.
Zurück in meinem Home-Office fahre ich den PC hoch und schalte den Fernseher ein. Ich zappe mich durch die Sendungen. Die Sender haben ihre Werbetexter auf das Oxymoron angesetzt. Da sitzt jeder für sich allein in seinem Home-Office und geht mit seinen Kollegen auf die Jagd nach einem neuen Oxymoron.
Es ist Anfang April. Wir haben sommerliche 26 Grad. Sommerliche Temperaturen im Frühling wäre ein meteorologisch aktuelles Beispiel für ein Oxymoron. . #AloneTogehter!
Der Widerspruch im Beiwort ist Programm. Die Contradictio in adjectu beherrscht inzwischen jeder. Allein zusammen stehen. Die soziale Distanzierung. Die Zuwendung auf Abstand halten. Es gibt sie zu Hauf, diese Oxymora. Wir gehen zusammen – auf Distanz. Die Sender umwerben mich. Und dich. Und dich. Und dich auch. Jeden einzeln und für sich. Wir halten zusammen – Abstand.
Der Mensch macht sich zum Haustier. Wozu Cafés und Restaurants? Essen kann jeder auch zu Hause. Das Home-Office ist der neue Stall zu Bethlehem. Die ersten Propheten versprechen eine bessere Welt und verkünden den Beginn einer neuen Zeitrechnung. Post-Coronam-Natum.Kapitel 18: SpaziergangWären die Kinder hier, würden wir vielleicht durch die Felder radeln. Vater, Mutter und Kinder sind erlaubt. Ansonsten nur pärchenweise. Die geraden Wege waren ihre erste große Freiheit. Auf den Feldwegen haben sie Radfahren gelernt. Überhaupt so vieles. Zuerst in der Wohnung geübt. Dann im Park ihre Sicherheit im Gehen und Laufen gewonnen und die ersten Runden mit dem Laufrad gedreht bis zum schwindlig werden. Danach radelten sie mit und ohne Stützräder. Zuletzt schleppten wir ihre Räder über die Berliner und übten auf den asphaltierten Wegen durch die Felder. Zu bestimmten Stunden waren sie verkehrsfrei. Die Wege sind schnurgerade, sodass wir immer in Blickkontakt blieben. Die Leine des Blicks ließ sie begeistert vorneweg radelten. Oder müde hinterher. Je nach Temperament und ausgeschlafen sein. Nein! Sie fehlen mir nicht. Über die Kleinkind-Idyllen sind sie längst hinaus. Nur in meiner Erinnerung sind sie noch lebendig. Die Zunahme ihrer Selbstständigkeit ist mein Verlust. Ich lass mich nicht länger von meinen Sentimentalitäten aufhalten.
Gemütlich schlendre ich durch den Park.
In unserem Park gehen keine alten Leutchen mehr, am Stock oder Rollator oder am Arm einer Tochter, die sie begleitet. Die Bänke sind verwaist. Auf dem Spielplatz spielt nicht ein einziges Kind. Dafür sind die Hunde von der Leine. Sie haben freien Auslauf und genießen alle Freiheiten. Was für ein Hundeleben!
Das Hundeleben führen derzeit die Menschen. Ihr Frauchen sagt "Platz!" Und alle kuschen.
Ich überquere die Berliner Straße mit ihrer Gleisanlage. Ignoriere die angebotenen Überquerungen und kürze ab. Ich komme heil hinüber, wo der Nonnenpfad von der Berliner abweicht. Der Pfad macht sich wieder frei und geht wieder seinen eigenen Weg.
Der Nonnenpfad führt mich am nördlichen Rand des Campus entlang. Immer geradeaus bis zum Fluss. Den rechten Arm gerade ausgestreckt, in zehn Zentimetern Abstand den äußeren Ärmel entlang. In Eugens GPS-Modell. In gemächlichem Schritttempo brauchte ich zwanzig Minuten. Heute will ich gehen und sehen. Und mir die Gewanne hersagen. Ich brauche keine Folie mehr mit den alten Gewannnamen.
Gleich nach der Pharma-Farm kommt der Kindergarten im Technologiepark, die Tagesstätte, in der unsere Kinder aufgewachsen sind. Vor dem Tennisklub zweigt ein Weg rechts ab. Er führt um die Sportanlage weitläufig herum. Nach wenigen Schritten endet hier die Trasse der Transportlinie der Oberrheinischen. Ich schaue in die Schneise hinein, die die Gärten schneidet. Wie der Broadway quer durch Manhattan.
Nussbäume flankieren den Weg. Ihre Kronen berühren sich und bilden einen schattigen Tunnel. Im Gestrüpp schimpfen Spatzen. Zwei Eichhörnchen huschen über den Weg. Sie jagen einander und jagen sich die Bäume hoch. Einer verschwindet in der Krone eines Nussbaums. Den andern habe ich aus den Augen verloren. Raben sind auf der Jagd. Sie platzieren sich auf die starken Äste. Im Herbst sammeln sie die Nüsse. Die lassen sie im Winter von großen Höhen auf den Asphalt knallen, immer wieder, bis sie aufspringen. Oder ein Auto kommt und sie plattfährt. Bin versucht, in die Hände zu klatschen und zu rufen. Raben lassen sich schon lange nicht mehr verjagen.
Da sehe ich das Eichhörnchen wieder. Es steht reglos kopfunter oben am Stamm, wo die Krone beginnt. Ein Rabe hat sich auf einen Ast des Baumes gesetzt. Eine Weile steht er wachsam und reglos. Dann hüpft er zweimal. Duckt sich und richtet er sich wieder auf. Immer wieder. Der Rabe hüpft. Das Hörnchen zuckt.
Dem Eichhörnchen müsste längst schwindlig geworden sein. Ich weiß nicht, wie es diese Starre aushalten kann. Jeden Augenblick erwarte ich, dass es bewusstlos kopfüber runterstürzt. Es ist mucksmäuschenstill.
Würde ich in die Hände klatschen oder rufen, verjage ich beide. Den Raben will ich loswerden. Dann kommt ein Hund gelaufen und bellt mich an. Als Kind habe ich gelernt, mit Überzeugung in der Stimme "aus" zu rufen. Ein Hund darf nicht meine Angst wittern. Er will streng behandelt werden. Oder liebevoll. Dann fühlt er sich willkommen, schnuppert und leckt.
Ich mag keine Hunde. Ich schreie ihn an, "Hau ab!" Er kuscht und winselt und verschwindet im Gebüsch. Und pisst seinen Schreck gegen einen Busch. Rabe und Eichhörnchen sind weg. Ich lege drei Erdnüsse unter den Baum. Soll sie holen, wer will. Oder der Hund kommt zurück und pisst drauf.
Ich überlege hin und her wie ich weitergehen will. Besser, ich schaue im Tennis-Club vorbei. Der Kellner bringt mir ein stilles Wasser. Wie immer, sagt er. Ein Viertelstündchen sitze und trinke ich im Club. Er wurde von seinem Platz im Kies vertrieben. An seiner Stelle steht jetzt das Parkhaus für Mitarbeiter der Medizinischen Wissenschaften.
Ich bleibe auf dem Nonnenpfad. Links ist der Landeplatz für den Helikopter. Rechts habe ich den Lehrgarten der Pädagogischen Hochschule. Er ist nicht breit, oder tief. Er liegt zwischen zwei Einmündungen. Der erste Weg nach Norden ist die Grenze zwischen Saubad und Hühnerstein. Die Pfädelsäcker habe ich vergessen zu erwähnen. Die lagen rechterhand vom Pfad in Höhe der Pharma-Farm. Und reichen bis zum Tennis-Club. Der Weg, an dem die Raben jagten, war die Grenze zwischen den Pfädelsäckern und dem Saubad.
Werner hat den Hühnerstein blockieren gewollt, so würde Onkel Eugen es sagen, in seiner Mundart eingefärbt.
Für meine Kinder kommt diese Krise zu früh. Selbst Axel bräuchte noch drei, vier Jahre, um die Natur dieser Krise zu durchschauen. Natürlich müsste ich sie ihm erklären. Er würde mich nicht verstehen. Wo er doch selber trainiert auf Teufel komm raus. Vielleicht will die Natur doch, dass wir Pflanzen züchten, und Hunde, Pferde und Katzen nach reinen Rassen. Und uns zu Höchstleistungssportlern trainieren auf Teufel komm raus!
Ich kann nicht immer ruhig bleiben. Wenn alles, was mein Leben lebenswert macht, mir verwehrt ist. Gelassenheit? Wo alles vorgeschrieben ist.
Dagegen hilft nur Gehen.
Ich kenne die Strecke auswendig. Bin sie tausendmal geradelt. Das Rad könnte mich blind ins Kolleg bringen. Gegenüber dem kleinen Lehrgarten der PH stößt der Bau INF672 an meinen Pfad. Irgendwer hat ihn Admin getauft. Violetta darf ihr Büro INF672 betreten. Dass die Zahlen passen, geht nur von hier aus. Das Home-Office ist zu unzuverlässig.
Linkerhand die Zentral-Ökonomie der Kliniken. Rechts das frisch geeggte Feld. Der zur Aussaat bereitete Acker endet an einer hohen Hecke, schön anzuschauen. Alles dahinter ist vernachlässigt, runtergekommen. Da hatte Werner sich mit seinen Tieren versteckt. Auch in mir steckt ein Bauernbub.
Der nächste Abzweig trennt den Hühnerstein vom Bodenmeister. Das Eck ist eine Rad-Werkstatt zum selber reparieren der Fahrräder in studentischer Selbstverwaltung. Nein! In studierender Selbstverwaltung. Eine Verwaltung, die selbst studiert. Der ganze große Bodenmeister ist Sportgelände der Universität.
Mitten in den neuen Studierenden-Wohnheimen liegt das Kolleg. Ich verkneife mir die Versuchung. Schnurstracks und stramm marschiere ich bis ans Ende des Pfads. Und stoße auf die Tiergartenstraße. Die überquere ich gehe die Verlängerung des Nonnenpfads bis zum Fluss. Rechterhand der Parkplatz vorm Tiergarten-Schwimmbad. Die Welt ist leer. Die Woche hat acht Tage Sonntagsruhe.
Ich hocke mich auf die oberen Stufen, die zum Kanal runterführen. Ich schwöre mir, so lange zu sitzen, bis ein Schiff vorüberkommt.
Heute bin ich zu weit gegangen. Der Rückweg wird mir lang werden. Die Beine sind steif vom Sitzen. Ich stehe auf. Die Knie schmerzen. Ich trete auf der Stelle. Dann kehre ich um.
Ich gehe den gleichen Weg zurück. Jetzt habe rechterhand den Campus-Im-Neuen-Feld. Mag man mich für verrückt halten. Ich bleibe dabei. Es sind Altdorfer Felder. Namen sind wie Zahlen. Sie stimmen und können so schön lügen. Müde komme ich heim. Blöde vertrödle ich diese öden Tage.Kapitel 19: NaturDie Natur ist wankelmütig. Von ihr hat der Mensch seine Stimmungsschwankungen. Ein kleines Kind baut seinen Turm. Und stößt ihn wieder um. Die Natur entwickelt und verwirft, was ihr nicht gefällt. Lässt es verkümmern und eingehen. Ihre Geduld ist wirklich erstaunlich. Sie denkt in Zeiträumen, die sich kein Mensch vorstellen kann. Sie hat viel probiert, bis herausgekommen ist, was sie sich als einen Menschen vorgestellt hat.
Da war er noch nicht mal ganz fertig. Er brauchte noch lange Zeit, um sich zu entwickeln, wie wir Menschen heute sind. Immer hat die Natur ihn sich verbessert. Als dem Menschen die Haare ausgegangen sind, lässt sie ihn Hemd, Hose und Hut erfinden. Die Natur hat den Menschen geschaffen. Und ihm dann freie Hand gelassen. Auch meine Gedanken sind ein Stück Natur.
In einem Ur-Knall hat sich das Weltall gebildet. Voll mit Energie spendenden Sonnen. Von den vielen Sonnensystemen hat eins einen Steinklumpen in einer chemo-physikalischen Zusammensetzung gebildet, woraus sich eine Natur entwickelt hat, der es gelungen ist, Lebewesen hervorzubringen. Das jüngste Exemplar dieser Pflanzen- und Tierpopulationen ist der Mensch. Seltsam, dass ein Urknall ein intelligentes Wesen hervorgebracht hat, das danach fragt, wie es geworden ist. Und auch warum und wozu. Ist doch verrückt! Gott ist natürlich nicht der Urknall. Er hat es vielleicht knallen lassen.
Noch immer herrscht der fromme Glaube vom guten und göttlichen Ursprung des Menschen. Das schmeichelt dem Menschen. Ich bin einer davon. Und fühle mich gebauchpinselt. Zwischen Urknall und Mensch steht die Natur.
Mit sechzehn begeistert Nietzsche. Durch ihn fühlte ich mich schon zu Schulzeiten unter die Philosophen versetzt. Dann hebt ein Lehrer skeptisch eine Augenbraue. Nietzsche? Ein Philosoph? Wenn du ihn als Philosoph siehst, wird er dir einer sein.
Der Geist hat lange gebraucht, um im Mensch vernünftig zu werden. Dieses Lebewesen mit Bewusstsein scheitert an seinem Körper. Es ist an seine Nerven gebunden. Sterben die Nerven, ist es auch aus mit dem Bewusstsein. Umgekehrt? Stirbt das Bewusstsein und die Nerven bestehen weiter? Verrückt! Warum nutzen sich die Dinge ab? Warum ist nicht auch der Körper unsterblich.
Das Tier, diese Pflanze aus Fleisch und Blut. Der Mensch ist noch immer ein zartes Pflänzchen, von dem keiner weiß, ob es gedeiht. Nur der Mensch glaubt, er wäre das Ziel der Natur. Kein Mensch weiß, was die Natur mit sich vorhat. Die Natur bewahren wollen, verweigert ihr, sich zu entwickeln. Was mag diesen Karl Benz getrieben haben, in der Werkstatt an einem Motor herumzubasteln, bis er funktionierte? Alle Menschen verdanken ihre Kraft, ihr Genie und Vermögen (sic!) der Natur. Wie jeder Normalsterbliche, der sich mit der Zeugung seiner Kinder zufrieden geben muss. Hätte dieser verdammte Karl Benz doch nur die Finger davon gelassen, wäre raus aus seiner Garage und Turnvater Jahn auf den Sportpatz gefolgt! Hätte er Sport getrieben, gäbe es heute keine Luftverschmutzung.
Wir wollen das Wetter machen, wie wir das Licht anknipsen. Der Mensch erwartet von sich, dass er es kann. Die Natur ist nicht das tägliche Wetter. Vielleicht hat sie den Mensch geschaffen, dass er ihr sagt, wer sie ist. Das tun Jugendliche gern.
Die Klimaforschung ist die unseriöseste der Wissenschaften. Ihr fehlt die Empirie. Sie ist spekulativ wie eine Religion. In sich selbst hat der Mensch jemanden gefunden, von dem er eine heile Welt verlangen kann. Sein Selbstbewusstsein schreibt sich dieses Können zu. Und schaltet seine Kreatürlichkeit in sich aus.
Die Natur hat ganze Tierarten aussterben lassen, von denen wir nichts wissen. Warum nicht auch Sportarten? Nach zwei Generationen erinnert sich kein Mensch mehr an den Motorsport. Eigentlich ist es ein Wettstreit von Technikern. Sehnsucht nach dem, was mal war. Warum ist die Erde nicht eine einzige milde, gemäßigte Zone!
Ich will nicht die Sommer und Winter meiner Eltern zurück.
Dass ich droben in Flex nicht mehr Ski laufen kann wie früher, daran sterbe ich nicht. Aber die Natur rund um Flex lebt wieder auf und grünt. Die sommers kackbraunen Schneisen berappeln sich langsam. Kein Mensch braucht zu renaturieren. Die Natur renaturiert sich selbst. Sie macht es gründlicher als jede Anpflanzung. Die Natur findet immer ein Samenkorn im hart getretenen Erdboden, das sie sprießen lassen kann. Fünf Jährchen und die Berge haben sich erholt.
Erst langsam und misstrauisch. Ob sie nächsten Winter nicht doch wieder Schnee tragen müsste, nur damit Skifahrer ihr die Buckel runterrutschen könnten. Nach drei, vier Saisonen, die ausgefallen sind, wächst das Vertrauen in Mutter Natur. Einfach wieder Berg sein. Statt Piste. Man muss ihr eine Pause gönnen, wie sich selbst.
Als die Natur den Spielplan der Fußballmeisterschaft Europas vors geistige Auge geführt bekam, ist ihr der Geduldsfaden gerissen. In jedem Land auf Europa wochenlanges Kick-Theater. Und den ganzen Sommer lang hin und her geflogen wie die Zugvögel. Da ist ihr der Kragen geplatzt. Sie zwingt alle Kontinente, dass sie ihre Menschen in Schutzhaft nehmen.
Trump will den Menschen das Sterben verbieten. Nach seinem Vorbild untersagen alle Politiker den Menschen zu sterben. Zumindest so lange, bis nicht mehr gezählt.
Die Macher-Menschen halten sich noch immer für schlauer. Sie setzen das Leben als Event fort. Das Fernsehen strahlt Fußballspiele aus, die vor Jahren gespielt wurden. Renner sind die Spiele zwischen Deutschland und Italien. In Italien die Spiele, die Italien gewonnen hat. Die Deutschen kriegen die deutschen Siege zu sehen.
Die Sportreporter haben nichts mehr zu berichten. Die Tageszeitung ist auf zwei Seiten Sport abgerutscht. Ergebnisse gibt es schon zu melden. Nur die Ergebnisse der Beratungen der Bosse der Vereine und Verbände des Sports. Sie entscheiden darüber, wie lange kein Sport getrieben wird. Zumindest geben sie vor, darüber zu entscheiden, was Covid19 längst entschieden hat. Covid der Neunzehnte lässt sich nicht sagen, wie lange er zu regieren hat. Eine Woche, einen Monat, ein Jahr? Die Bosse heben ihre Hand zum Zeichen ihrer Zustimmung zu ihren Beschlüssen, wie die Parlamentarier der Sowjet-Union. Weiter will ich den Vergleich nicht ziehen. Alle vier Wochen geht’s in die Verlängerung. Eine Woche. Noch eine Woche. Noch bis zum 19. Oder doch bis zum 30. Bis ultimo. Täglich laufen Wasserstandsmeldungen des Sports für ein Reset über den Bildschirm. Mal Abbruch, Neustart, Fortsetzung, Einfrieren der momentanen Tabelle. Alles Trockenübungen.
Vielleicht können Sportreporter inzwischen über Covid19 selbst schreiben. Covid19 ist hier Akkusativ und als Covid den Neunzehnten zu lesen. Die Coviden sind eine Nebenlinie der Coronaden. Covid19 ist der wahre Welt-Meister! Die Größten der Weltgeschichte sind Zwerge gegen ihn. Egal wie sie heißen. Dschingis Khan, Darius, Atilla, Alexander, Julius Caesar. Oder Karl. Wie gemütlich ritt es sich in der Zeit der Gäule durch die Welt. Elefanten waren die Panzer der Gaul-Zeit-Kriege. Bis Karl Benz das Auto erfunden hat.
Der Ball muss flach gehalten werden. Um zeitnächst wieder zu rollen.
Aber das Leben ist keine Fernsehsendung.
Obwohl wir uns in einigen Sitcoms fühlen, wie mit der eigenen Verwandtschaft. Man hat sie gerne bei sich. Und ist nicht weniger froh, wenn der Besuch wieder geht.Kapitel 20: PhilosophieFußball ist der langweiligste Mannschaftssport. Da ist jeder Kirchenchor aufregender. Da sind Männlein und Weiblein gemischt. Fußball ist das langweiligste Ballspiel. Darum machen die Zuschauer ihre eigenen Inszenierungen.
Für einen kompletten Spieltag der Bundesliga mit regelkonformen 9x90 Minuten Spieldauer genügen dem Fernsehen fünf Minuten. Mehr High-Lights in 810 Minuten schafft die Kick-Kunst nicht. Schau dir ein Spiel in voller Länge an! Dann weißt du, warum Fußball so langweilig ist.
Fußball wird langweilig, sobald wir aus den Kinderschuhen herausgewachsen sind. In der Kindheit dürfen hinter dem Ball her rennen. Wir rennen dorthin, wo der Ball ist. Wenn ich den Ball kriege, gebe ich ihm einen Tritt. Dann bleiben alle stehen, sind geschafft und zufrieden mit sich. Das ist Fußball. Kein vernünftiger Erwachsener würde seine Kindheit mit Kicken verlängern wollen, bis Mitte dreißig. Aber sie kicken weiter. Bis zur Champions League rauf. Bis die Fitness weg ist und den Jungen hinterherhecheln. Und die Gelenke kaputt sind.
Das ist eigentlich das Schöne am Sport. Diese natürliche Selektion der Fittesten. Keiner fragt sie, wie es ihnen geht, wenn sie mal sechzig sind.
Dass mit diesem langweiligen Sport derartige Summen umgesetzt werden, liegt an seiner Popularität. Das Volk ist nun mal so gestrickt, dass es rumschreien und ausrasten will. Dies ist im Stadion erlaubt und gewünscht. Wenn von Populismus gesprochen werden kann, dann im Fußball. Seinen Fans lässt er alles durchgegen. Bei der Arbeit kann sich keiner so gehen lassen. Renne mal einer wütend auf seinen Kollegen zu, oder baue sich vor seinem Chef mit breiter Brust auf wie ein Kicker vorm Schiri! Sowas geht nur im Stadion. Auf dem Feld.
Ein Mercedes ist ganz schön teuer. Aber gegen die Preise für Kicker-Beine ein Schnäppchen. Ein Wirtschaftsphänomen, das zu bewundern ist, bleiben die Summen trotzdem. Warum sollte mein Sohn noch studieren! Bei der Tochter ersetzt der Sport ein ordentliches Einkommen für ein sorgenfreies Leben in Wohlstand bis ins hohe Alter noch nicht.
Ich bestreite gar nicht, dass es im Sport Unterschiede gibt. Jeder spürt es am eigenen Leib. Eine Weile geht es ganz ordentlich, dann kommt der Moment, wo ich spüre, ich kann nicht mehr mithalten. Darum bewundern wir die Sportler, die uns die Messlatte derart hoch legen, dass wir drunter durchschlüpfen.
Beim Volkssport Fußball fällt es am leichtesten, lange Zeit ans eigene Können zu glauben. Da kann ich einige Jahre gut mithalten. Fußball entspricht offenbar einem natürlichen Bedürfnis. Andere Sportarten haben es da schwerer.
Das Spielfeld war zu Turnvater Jahns Zeiten der Spielplatz für Kinder. Ein brachliegender Acker, auf der die Dorfkinder spielen und kämpfen durften, ohne verjagt zu werden. Das Stück Brache wechselte meist jährlich. Jeder Bauer kam an die Reihe. Der Spielplatz ist noch heute für Kinder unter vierzehn Jahren freigegeben. Zu Jahns Zeiten waren die Vierzehnjährigen aus der Schule und haben gearbeitet. So romantisch-verklärt hat das Kicken mal angefangen.
Jedes Kind bringt ein gewisses Talent für Fußball mit auf die Welt. Wer keins mitbekommen hat, der rennt einfach den andern hinterher. Der Schnellste ist als Erster am Ball. Selbst die wenigen mit einem Super-Talent kommen ums Rennen nicht ganz herum.
Für einen Fallrückzieher war ich zu ungelenk. Einen gelungenen Kunstschuss genial zu nennen, kann ich verstehen. Ein Fußballtalent als Genie zu bezeichnen, finde ich übertrieben.
Heute sind die Profi-Fußball-Trainer gezwungen, eine Philosophie zu kreieren. Bei drei Profi-Ligen mit 18 Teams macht das 54 Philosophen, die in Lohn und Brot stehen.
Taktik und Mätzchen als eine Philosophie auszugeben, ist der reinste Schwachsinn. Gerade bei den Profis heißt jede Taktik und das taktische Foul trotzdem sehr wohl Philosophie. Auch die aufs Feld geschriene Anweisung Hau den Ball ins Aus! gilt als Weisheit. Fußball kennt nur eine Taktik. Rennen und nochmal rennen, bis die Lungen brennen.
Die Fußball-Philosophen entwickeln ihre Spieler. Sie bringen den Spielern das Laufen bei. Als hätten ihre Kicker nie laufen gelernt. Im Fußball gewinnt, wer die schnellsten Beine hat. Und vorwärts rennt es sich schneller als rückwärts. Also immer nach vorn vors gegnerische Tor. Obwohl nicht das Tor der Gegner ist, sondern die im andern Trikot. Nein! Nicht die Profis sind die Bösen und die Amateure die Guten. Das Übel ist, dass alle Amateure am liebsten Profi werden wollen. Ich seh’s an unserm Axel.
Darum sind Clubhaus und Trainingsgelände heute zu einer Akademie für Bratwurst, rot-weiß, mit Pommes geworden. Um namensrechtlichen Schwierigkeiten aus dem Weg, schreibt der Fußball sich Academy. So kollidiert kein Sportverein mit der Akademie der Wissenschaft.
Ein anderer Grund für die Langweile des Fußballs ist sein Spielfeld. Der Platz ist viel zu groß. Es gibt viel zu viele freie Räume zwischen den Spielern, die auf dem Platz stehen. Ein halb so großes Spielfeld täte es auch. Es braucht dann keine langen Bälle mehr. Mehr Pässe kämen an. Der Kurzpass verlangt einen hellen Kopf für kluge Schachzüge. Sie würden das Spiel schneller machen, ohne dass sich die Spieler die Lunge aus dem Leib rennen müssten. Und es würden weniger Fouls begangen, da keiner mehr einen so langen Anlauf nehmen müsste und rechtzeitig abbremsen könnte. Statt den Gegner über den Haufen zu laufen. Die taktischen Fouls kämen aus der Mode. Und eine Stunde wäre auch genug. Mit einer Halbzeit-Pause nach dreißig Minuten.
Wie wirkmächtig der Fußball ist, der alle anderen Sportarten frisst, hat sich gerade erwiesen. Der Autor der Angst des Tormanns vorm Elfmeter wurde mit dem Nobelpreis für Literatur ausgezeichnet. Diesem Henkel-Pott der Schreibkunst.
Wir tun alle so, als wäre nächste Woche alles vorbei. Und das Kicken geht weiter.
Mit Geisterspielen soll angefangen werden. Dann fließen die Fernseh-Gelder wieder. Vor leeren Rängen? Das Stadion mit Soundtrack. Zum Flutlicht die passende Geräuschkulisse eingespielt. Fertig ist der Karaoke-Fußball. Nur über den Zaun klettern ist schwierig nachzumachen. Aber Lacher, Gebrüll, Pfeifkonzert, Gegröle, Schiebung, Schiedsrichter Telefon, Trommeln, Pauken und Tröten! Wie der Motorsound bei flüsterleisen Elektro-Motoren, dass der Fußgänger den Tesla kommen hört. Die Hauptsache, es geht weiter. Geisterspiele ohne Zuschauer sind wichtig, dass die Fernseh-Millionen nicht verloren gehen.
Und die Bosse der Vereine und Verbände des Sports treffen weiter Entscheidungen darüber, wie lange kein Sport getrieben wird. Und dass nach der Krise der Sport die Gesellschaft retten wird. Soziologen sind die Fußballer auch noch. Komplette Teams gehen in Quarantäne. Auch hierin Vorbilder. Vorreiter, die sich opfern. Sich infizieren, ohne zu erkranken. Und Mut machen.
Solange der Ball ruht, ist Zeit gewonnen. Dass fieberhaft (sic!) an der Entwicklung von Impfstoffen und Tests gearbeitet werden kann. Eine Impfung ist die dosierte Ansteckung. Alle bereits Infizierten brauchen keine Impfung mehr. Sie sind verimpft.
Violetta hatte sich eine Auszeit von Werner gegönnt. Sie hat mich gebeten, ein Auge auf Werner zu haben. Ihr Kirchenchor war zwei Wochen in Südafrika. Vor jedem Konzert wurde den Sängern die Körpertemperatur gemessen. Zurück in Frankfurt wurden sie im besten Gottvertrauen durchgewinkt. Jetzt sitzt jeder bei sich zu Hause. Harren und bangen. Harren aus, ob die Heimkehrer ihre Lieben anstecken. Vor innerer Unruhe weiß keiner was mit sich anzufangen.
Heidrun liest all ihre Angélique-Bände nochmal von vorn. Nachmittags gibt es Liebe aus Leidenschaft.
Am frühen Abend singen Chöre Choräle von den Balkonen. Die Kirchen sind geschlossen. Auf einmal finde ich Gott überall. Postet der Pastor auf Facebook und Twitter.
Mein Türke hat auch geschlossen. Ümül der Schneider. Wie sollte er Hemd und Hose anpassen? Mit bloßem Auge aus zwei Metern Entfernung. Wir sind ein Kontinent von Schneidern. Wir nähen unseren Mundschutz selbst. Dass die Kliniken versorgt bleiben.
Ich hange und bange wie jeder. Bis die statistische Infektionsquote von 80 Prozent erreicht sein wird. Dann werden wir wieder rausgehen und Kontakte haben. Mit 80 Prozent ist die Bevölkerung durchinfiziert. Der Virus findet einfach keinen mehr, den es noch anstecken könnte. Vier müssen ihren Körper hinhalten. Einer von fünfen kommt ungeschoren davon.
Die ganze Corona ist ein globaler Intelligenztest. Ich erinnere mich an eine Definition von Intelligenz. Sie ist Anpassung. Die viel geprügelte Anpassung. Anpassung meint lernen, um klarzukommen, ins Reine, mit mir selbst und dem Außermir. Die Frage, wer sich am schnellsten nervös machen lässt und verrückt wird.
Zurück zur Natur! Dieser Verursacherin!
Die Natur ist ein Auswickeln. Sie war noch nie damit zufrieden, wie sie von Natur aus ist. Kein Mensch weiß, was sie mit sich vorhat. Oder mit uns. Sie experimentiert in unseren Handlungen. Der Mensch will der Natur auf die Schliche kommen. Oder ist es die Natur, die dem Menschen die Erforschung ihrer Natur aufhalst? Dass Sportwissenschaft keine Wissenschaft ist, zeigt die Natur gerade drastisch. Ist schon lustig, dass keiner mehr Sport treiben kann. Vielleicht nimmt die Natur in einem Aufwasch auch den Naturforschern ihr Objekt. Und den Geisteswissenschaftlern? Wie sieht’s bei denen aus.
Im Schalker Bankrott beißt nicht nur ein Verein ins Gras. Warum soll nicht die ganze Sportkultur vom Erdboden verschwinden. Kulturen sind schon immer untergangen. Sportler sind nicht die höchsten Wesen. Die Natur hat den Mensch nicht geschaffen für zwei Meter und mehr. Der Größte soll über zwei Meter siebzig gewesen sein und an einer lächerlichen Fußverletzung gestorben sein. Die Natur will diesen Mensch nicht. Sport ist keine kulturelle Leistung. Im Sport versinkt der Mensch im Tier.
Die Natur fordert unseren Kopf. Sport, dieser Ersatz für schwere körperliche Arbeit, die heute dem Menschen erspart bleibt. Der Sportler sucht sie und quält sich dafür.
Die Menschheit hat es geschafft, in wenigen Jahren die Natur zu ruinieren. Aber die Natur lässt sich nicht sagen, was gut für sie ist. Und hält dagegen.
Es schmerzt, wenn die Natur reguliert. Ein derart hartes Durchgreifen hätte ich ihr nicht zugetraut. Mir liegt das Wort Entfaltung auf der Zunge. Sie entfaltet sich. Was in den Falten verborgen liegt, wird durch Straffen sichtbar. Jetzt strafft sie sich plötzlich. Wir purzeln vom Strandtuch, auf dem es sich bequem sonnenbaden ließ.
Ich bin Brillenträger. Mit Brille hast du keine Chance im Sport. Sportler brauchen einen gesunden Körper. Diese lebenslange Verletzung bietet mir Gelegenheit, nach meinem Geist zu schauen, der in meinem Körper steckt. Ob der mithalten kann. Oder die Physis ihm davongelaufen ist.
Protestantisch ist, mir meine eigenen Gedanken zu machen. Gott habe den Menschen geschaffen, um auf der Erde Fuß zu fassen.
Ich messe vor dem Frühstück die Körpertemperatur. Und am Abend nochmal. Wusste nicht, dass ein Mensch abends ein halbes Grad heißer ist.
Birgit und die Kinder sitzen erst einmal fest. Ist erstmal nicht weiter schlimm. 2.200 Meter überm Meeresspiegel ist nicht der schlechteste Aufenthalt, im Fexer Wald Hotel eingesperrt zu sein. Sie haben den Hund dabei. Er vertreibt ihnen die Zeit. Zweimal am Tag dürften sie ihn auch hier drunten ausführen. Ein Hund muss Gassi gehen. Das erlaubt ihm jeder Politiker.
Birgit sitzt am Panorama Fenster. Das war schon immer ihr favorisierter Platz. Von da bewundert sie so von oben herab den Silser See. Ich sitze daheim und warte ab, bis die Infizierung der Menschen abgeschlossen ist. Nicht jeder, der sich infiziert, erkrankt. Damit mache ich mir Mut. Nicht jeder Erkrankte muss daran sterben. Das höre ich gern. So tröste ich mich. Gläubige leben immer nahe am Selbstbetrug. Das Warten geht mir auf den Geist. Und beißt dann wieder heftig ins eigene Fleisch.
Die Nachrichten über die Verbreitung der Seuche ersetzen mir die Sportresultate. Olympia ist zäh wie ein ungeklopftes Steak. Olympia ist kein Fußballspiel. Die Olympischen Vier Jahre sind ein heiliger Brauch. Weihnachten würde auch nicht ausfallen aufgrund einer Lungenentzündung des Heiligen Vaters.
Allzu viel geht mir nicht ab. Ich könnte mit Birgit nicht mal Hand in Hand spazieren gehen. Das wirkte derzeit als Provokation. Im zwei Meter Abstand nebeneinander hergehen? Die Kinder hätten nach drei Schritten es eh ́ vergessen und würden vorlaufen und wieder zurückkommen, um was zu zeigen oder zu berichten. Und der Hund? Die Hundeschulen florieren und haben alle Hände voll zu tun, unsere Hunde auf zwei Meter Abstand zu dressieren.
Nur raus aus dem Gefängnis der eigenen vier Wände. Es bedrückt mich, worin ich mich wohnlich eingerichtet habe.Kapitel 21: HeimkehrKollege Danilo hat sich zurückgemeldet. Frisch und munter aus Mallorca heimgekehrt. Wie weitere 40.000 Urlauber vom Bund heimgeholt. Jeder hat ein Recht auf Heimführung in die Heimat. Eine Woche hat es gedauert, bis alle aus- und eingeflogen waren. Es sei zügig und ohne Störung gelaufen. Weder vorm Einsteigen noch nach dem Landen wäre einem einzigen Urlauber die Körpertemperatur gemessen worden. Schnell, schnell nach Hause in die Quarantäne.
Danilo macht die Koordination und hält Kontakt zu den Studierenden. Und zu den Lehrenden gleich mit. Ein Anruf wäre persönlicher. Doch die Zeiten sind nun mal so, wie sie sind.
Am Kolleg läuft alles über Home-Office. Das Leben geht weiter. Eine zweite gute Nachricht hatte Danilo. Er besitze einen Schlüssel zum Klopapier-Vorrat im Kolleg. Wenn gar nichts mehr geht, kann ich darauf zurückgreifen.
Er überlegt, noch fluchs nach Hause zu den Eltern in den Schwarzwald zu fahren. Es gibt einen Nachtzug um 4 Uhr in der Früh. Der ist auch zu gesunden Zeiten leer.
Er könne auch Pizza Bäcker. Seine Eltern dürfen aus dem Fenster to go verkaufen, portare via sagen sie als Italiener. Dieses Fass wolle er nicht auch noch aufmachen.
Ernsthaft!
Ernsthaft arbeite er daran, dass wir den Unterricht online durchführen könnten.
Danilo hat sich die beiden Filmklassiker zum Ausbruch angeschaut. Das hielten meine Nerven nicht aus. Nach fünfzehn Jahren hat er seine Gitarre aus dem Kasten geholt und spielt wieder. Die Gelenkigkeit der Finger lassen zu wünschen übrig. Vielleicht bringt ihn die Seuche zur Konzertreife. Zumindest, dass er sich zutraut, mal wieder vor Publikum zu spielen. Im engeren Kolleg-Kreis, vielleicht ein paar Studierende und besondere Gäste, die nicht so kritisch sind. Und infiziert, also immunisiert. Er könne mich begleiten via Skype, wenn mir nach Singen zumute sei.
Wir hatten viel zu lachen.
Onkel Eugen ist bei Heidrun gut versorgt. Violetta hat es noch einen Dreh schwerer mit ihrem Werner. Er ist nicht vom Feld runterzukriegen. So lange die Seuche herrscht, hat er Freigang im Gelände. Immerhin da gewinnt er mal. Eine große Flucht ist in Bewegung. Alle haben das Feld geräumt. Keine Studierenden, keine Professoren. Die Institute sind geschlossen, die Bibliothek, die Haustechniker machen Notdienst du tun nur das Nötigste. Wie schon immer. Solange Werner niemand umbringt, drückt jeder ein Auge zu. Covid19 hat den Campus stillgelegt. Ich sehe Werner an seiner Speaker’s Corner und lese seine Gedanken. Triumph! Triumph!
Nach Ober-Flex kommuniziere ich virus-frei von Haus zu Haus. Skype liegt mir nicht. Brauche es aber tagtäglich, um meine Kinder zu sehen. Die zerren als erstes den Hund vor die Kamera. Zuletzt erscheint Birgit.
Die Baustelle AudiMax liegt still. Was Werner macht? Ist längst durch den Bauzaun auf seinen alten Platz ins Gebüsch bei der Chemie geschlüpft. Heim-Office hat ihre Grenzen. Maurer kannst du nicht so mir nichts, dir nichts auf Heimarbeit umstellen. Eugen macht eine Handbewegung, als würde er einen Schalter umlegen. Auf der Baustelle tut sich nichts mehr. Ein Wachdienst? Wohl eher nicht. Die Krise ist eh ́ schon ein großer Kostentreiber. Die Maurer kriegen ihr Kurzarbeitergeld. Bei frühlingshaften Temperaturen ist schlecht auf Schlechtwettergeld zu buchen. Das kann nicht mal eine Kanzlerin erzwingen. Der Haushalt ist das höchste Gut. Er muss stimmen. Dafür wird jetzt alles über den Haufen geworfen. Die Länder stehen vor dem Ruin. In den Kriegen wurde so viel Wohlstand vernichtet. Nein! Ich mag diesen Vergleich nicht. Auch sonst wird reichlich gegen das Grundgesetz verstoßen.
Und alles bei schönstem Wetter, das einlädt zum Rausgehen. Sommerliche Temperaturen im Frühling (sic!).
Ich freue mich über jedes Kind in unserem Park. Sie kommen erst spät am Nachmittag, so gegen fünf. Ich durchschaue das Spiel der Eltern. So kriegen die Kleinen nochmal frische Luft und toben sich ein wenig müde. Und gehen williger ins Bett und schlafen besser.
Der Virus ist keine Schnaken-Plage. Mit einem Fliegengitter ist ihm nicht beizukommen. Ich folge nicht der allgemeinen Sprachregelung. Ich verwende Virus nicht als Neutrum. Das Virus klingt mir zu neutral. So unschuldig wie ein Kind. Als könnte er weder Mann noch Frau was antun. Ich sage der Virus. Er ist ein Hund. Und von der Leine gelassen.
Kein Mensch mehr auf der Straße, den er beißen könnte. Wir bleiben in unseren vier Wänden. Brav machen alle mit! Kein Mut zum Ungehorsam. Ruhe ist die erste Bürgerpflicht. So und nicht anders soll dem gefräßigen Biest die Lebensgrundlage entzogen werden. Ist doch zum Lachen.
Ruhe ist die erste Bürgerpflicht. Hätte mir nicht träumen lassen, dass die Schlacht bei Jena von 1806 noch derart Nachwirkungen zeitigt. Bei Jena haben die Preußen verloren, Napoleon gewonnen. Wie könnte ein Lehrer für Geschichte das vergessen. Unser Hausarrest bleibt eine Verteufelung der Straße. Da lasse ich kein Vernünfteln gelten.
Was machen meine Verrückten, die auf der Straße leben? Sie sind auf der Straße zu Haus.
Eine Epidemie, altgriechisch ἐπί epí‚ "bei", und δῆμος dēmos, "Volk", ist eine Krankheit beim Volk, eine Volkskrankheit. Eine ausgewachsene Seuche. Ein scheußliches Wort aus dem Mittelalter. Das Wasser ist vielleicht verseucht. Der Boden. Aber nicht wir modernen Menschen.
Trotzdem fallen wir auf das alte Jäger-Latein der Mediziner rein und werden abgelenkt von Epidemie durch Pandemie. Damit sind wir erstmal beschäftigt. Epidemie war schon immer die Verharmlosung für Seuche. Und Harm bedeutet Kummer, Leid, Schmerz. Also der Seuche sollen Schmerz, Kummer und Leid genommen werden. Bildlich gesprochen: der Zahn gezogen. Pan ist bloße Quantifizierung. Das vermehrte Auftreten von Krankheitsfällen in einer Bevölkerung heißt Pandemie. Der Virus kommt überall hin. Er trifft alle Bevölkerungen. Pandämonie würde unsere Lebenslage besser beschreiben.
Ich suche die Ansteckung. Die Selbst-Impfung.
Dann ist es ausgestanden. Und erhöhe die Ansteckungsrate, dass endlich die Quote erreicht ist. Natürlich steigen die Zahlen der Ansteckungen. Weil endlich angefangen wurde zu zählen. Und statt Ansteckung, was jeder versteht und stärker empfindet, heißt es Infizierung. Auch so ein Mediziner-Latein-Wegzauberwort. Wer kriegt schon stolperfrei Infiziermichnicht durch die Atemschutzmaske.
Trage ich eine Maske? Oder trage ich besser keine?
Trage ich den Mundschutz, oute ich mich dann als Gefahr für andere. Trage ich keinen, oute ich mich als Bruder Leichtfuß. Ich weiß nicht, was tun.
Violetta fragen?
Tu, was du für richtig hältst!
Die Distanz ist das Maß aller Dinge. Die Distanzierung sei eine Tugend. Der Vorsprung beim Laufen eine rein sportliche Angelegenheit.
In gesunden Zeiten gehe ich spontan auf den andern zu. Jetzt wehre ich ihn ab. Das Misstrauen, die schlimmster aller Nebenwirkungen. Wo ich Ungehorsam erwartet hätte, finde ich nur brave, eingeschüchterte Nachbeter. Der Ungehorsam ist verloren gegangen. Ungehorsam ist die Hefe der Geschichte. Das Dümmste am Virus ist der Mensch.
Ein Kontinent muss sich von Grund auf neu sozialisieren.Kapitel 22: VerzweiflungMeine Mobilität endet in einer Quarantäne. Meine Fußfesseln sind unsichtbar. Wer sich nicht einquarantäniert, wird sterben. Die Lungenentzündung ist ein Ersticken.
Am meisten leiden die Menschen, dass sie keinen Sport treiben können. Vielleicht hilft, wenn ich verspreche, ein besserer Lehrer zu werden?
Ich gehe bescheiden Tag um Tag meine Wege. Der Leerlauf der Gedanken führt mich spazieren. Totenstille zu Lebzeiten. Eine Sintflut. Was hat sich die Natur dabei gedacht! Warum jetzt das Ende ihrer Geduld. Was tut sie sich an, wenn sie uns quält? Wen will sie weg? Wen will sie behalten? Sie zerstört sich selbst, wenn ich sterbe. Mit ihrem Virus ist ihr eine große Verrücktheit gelungen.
Ich bin ein aufgeklärter Mensch. Mein Leben erscheint mir inzwischen verwickelter, als ich mir hätte träumen lassen. Zunehmend erhalte ich anonyme Anrufe. Es sind Anrufer, die ihre Nummern unterdrücken. Wenn sie sich verstecken wollen, warum rufen sie dann an? Anonyme sollten anonym bleiben. Oder aus ihrem Versteck herauskommen.
Ich verfüge über unendliche Zeit, um diese leidige Geschichte der Verrückten zu Ende zu bringen.
Wenn ich nicht meine Wege gehe, sitze ich brav daheim und warte auf die Ansteckung. Die so sicher kommt wie der Mann vom DHL. Irgendwann zwischen 9 und 13 Uhr. Statt vier Stunden Warterei sind es bei Covid19 vier Tage oder Wochen. Doch bin ich dieser Fünfte, der verschont bleibt vom Virus, werde ich mich impfen lassen müssen. Bis dahin tue ich so, als gäbe es mich nicht.
Ich komme an der Haltestelle Technologiepark vorbei, die leer steht. Da fragt mich doch ein Plakat: Was hast du heute Gutes getan? Eine ganze Liste moralischer Fragen tapeziert den Wartebereich aus. ReFood! Alles, was beim Essen übrig bleibt. – ReFood? Sagt man heute so statt Schweinefutter? Ein Fuhrwerk mit einer Fasstonne. Damit wurden die Haushalte und Höfe abgefahren, die Essensreste eingesammelt und den Schweinen verfüttert. Der Urgedanke der Müllabfuhr. Linus ist davon reich geworden. Noch reicher als der Sau Bechtel. Bis die geschlachtet und von uns aufgefuttert werden, ... den Gedanken will ich nicht zu Ende denken. Willst du jemandem das Leben retten? Es gibt kein Entkommen vor diesen Moral-Slogans. Ethik würde weniger moralisch klingen als Moral. Ethik ist weniger plump.
Mein Leben ist ein Vorgang, den die Chemie steuert. Hormone und Blutwerte. In uns steckt noch immer das Tier. Was wir essen, macht glücklich oder traurig, nicht nur satt. Zu wenig Calcium im Blut bringt den Herzschlag durcheinander. Jede Tasse Kaffee, die ich trinke, ist ein Doping, damit ich den Tag beginnen kann.
Ich habe kein Problem damit, dass ich ein Tier bin. Meine unvergängliche Angst vor den Turbulenzen der Pubertät, dass ich doch kein höheres Wesen bin? Ich lobe nicht das Tier! Auch wenn es mir näher steht als die Pflanze. Tierliebe bedeutet immer einen Schritt zurück. Auch Streichwurst tut so, als wäre sie Butter auf dem Brot.
Warum sind Materie und Geist nicht fein säuberlich und strikt voneinander getrennt. Diese Koedukation durch die Natur.
Warum braucht der Geist den Körper, der Gedanke ein Hirn als Mittel zu seinem Zweck. Der Mathematiker sagt von sich, nicht die Zahlen, die er an das White Board schreibt, ist Mathe, sondern was er sich dabei denkt. Erinnert es nicht an Dichtung? Der Text, den ich schreibe, ist es nicht. Nur die Materie von was auch immer.
Die Liebe zu Tieren ist nicht zielführend. Sie entrollt nicht den Teppich der Evolution. Sie entfaltet kein Tuch. Sie ist eine Rolle rückwärts zum Tier. Das Tier, diese Pflanze aus Fleisch und Blut. Auch der Mensch, diese seltsame Pflanze im großen Weltgarten. Es ist verdächtig still um den Menschen geworden. Erscheint als Fehlgriff der Natur.
Dass ich ein- und ausgesperrt lebe, bin ich nun gewohnt. Top Gear ist kein Ersatz für Live Übertragungen. Mir fehlt der Sport im Fernsehen. Ich muss raus aus dem Haus. Viel geht mir nicht ab, dass Birgit und die Kinder im Wald Hotel festsitzen. Die Speisekarte nennen sie dort Konsumationsliste. Darf ich Ihnen die Konsumationsliste reichen? So sagen sie da. Im Freien ist jeder Kontakt verboten. Ich grüße distanziert mit einem Kopfnicken. Keiner wagt ein freundliches Wort. Aus Mangel an Anreizen bin ich gereizt. Als spuckte ich statt Worten Viren aus.Kapitel 23: SystemkritikSystemkritisch ist ein so missverständlicher Begriff wie die Sozialen Medien. Mit sozialem Verhalten haben die nichts zu tun. Nein! Ebenso wenig bedeutet systemkritisch eine kritische Meinung dem Gesellschaftssystem gegenüber.
Systemkritisch meint, wenn bestimmte Betriebe und Einrichtungen geschlossen würden, würde es kritisch für das Gemeinwesen. System-Kritische Einrichtungen sind die Supermärkte. Sie müssen zur Versorgung der Bevölkerung offengehalten werden.
Die Systemkritischsten Einrichtungen sind die Krankenhäuser. Von ihnen erhofft sich die Politik die Rettung aus der Covid’schen Weltkrise. Sie und eine Handvoll Forschungsinstitute sind Systemkritische Betriebe von höchster Priorität. Vorneweg die Charité und das RKI. Weil neun von zehn Fernsehzuschauern sich das RKI mit Rotes-Kreuz-International übersetzen, sei ihnen versichert, das Rote Kreuz ist mit RKI nicht gemeint. Charity bedeutet Nächstenliebe, Wohltätigkeit, Almosen. Den Kliniken und medizinischen Forschungsinstituten wird derzeit zurecht höchste Priorität vor allen andern Einrichtungen zum Wohl und Erhalt der Menschheit eingeräumt. Denn darum geht es bei dem Kampf gegen das Covid19-Syndrom. Das Aussterben des Menschen, der unwiederbringliche Verlust einer Tierart.
Selbst die Praxen niedergelassener Ärzte, deren Arbeit tendenziell dem Wohlstand ihrer Betreiber dienen, zählen zu den Systemkritischen Einrichtungen und dürfen geöffnet bleiben.
In einer gewissen Grauzone existieren Alten- und Pflegeheime, Tagesstätten für Alzheimer-Verwirrte, Einrichtungen zu Wiedereingliederung von Suchtkranken und Wohnungslosen. Sie sind keine Wohnsitzlose! Einen Wohnsitz hat jeder von ihnen. Gerade Suchtkranke und Wohnungslose sind der Polizei bekannt.
Diese Hilfen zur Wiedereingliederung von Suchtkranken und Wohnungslosen in die Gesellschaft gehören seit acht Tagen zu den Systemkritischen Einrichtungen.
Als Student für Sport war ich jeden Donnerstag im Berghof. Es gab ein halbes Fußballfeld, einen Kickplatz etwa 30 mal 50 Meter. Mit zwei Toren und einem hohen Maschendrahtzaun ringsum. Dass der Ball nicht bei jedem Schuss im den Wald gesucht werden musste. Und nicht, dass die Kicker im Zaun gehalten wurden.
Auch der Boden war recht ordentlich. Schwarzer Aschensand. Gräser sprossen aus dem Ascheboden. Die Bergseite war immer leicht vermoost und etwas glitschig. Zum Warmmachen drehten wir ein paar Runden, immer schön den Zaun entlang. Die Runde rechneten wir als eine Strecke von 150 Metern. Drei Runden galten als eine Stadionrunde. Mit meinen Sportstunden im Berghof habe ich mein erstes Auto finanziert.
Der Leiter dieser Einrichtung hat angefragt, ob ich Ostern nicht aushelfen könnte.
"Gern! Im Grunde schon."
"Aber?"
"Ist Sport derzeit nicht verboten? Oder wird eine Ausnahme gemacht?"
Ich habe von ihm gelernt, was eine Sucht ist. Ob Alkohol oder Drogen, darauf kommt es nicht an. Diagnose und Therapie ist Sache der Psychiatrie und Psychologen. Im Wesen des Menschen liegt diese Sucht nach Erlebnis. Ein interessantes, spannendes Leben leben wollen. Daran dachte ich wieder zurück. Diese Grundveranlagung zur Sucht: die Sucht nach einem spannenden Leben. Ein Leben als ein kontinuierliches Event.
Wir plauderten eine Weile. Kamen schließlich von früher zur Gegenwart. Ob ich nicht an den bevorstehenden Feiertagen ehrenamtlich aushelfen könnte. Ihm seien in letzter Zeit zu viele Ehrenamtliche abhandengekommen.
"Davongelaufen?"
Der Pool der Ehrenamtlichen sei leer. Keiner wolle Gefahr laufen, sich einer Infizierung durch den Virus auszusetzten. In ihrer Disziplinlosigkeit halten sich Suchtkranke an keine Verhaltensregeln, das war schon immer so. auch beim Kicken. Die doppelte und jetzt dreifache soziale Distanzierung ertragen die Suchtkranken nicht.
Wie er das meine, fragte ich.
Ausgesperrt und eingesperrt.
Die Ablehnung, die sie überall erfahren, provoziert unter ihnen eine gelegentliche Solidarität. Outlaws zu heißen, macht sie stolz. Dieses Gefühl, Mitglied einer Gruppe zu sein, wird ihnen jetzt verboten. Jeder lebt allein. Er müsse den Laden schließen.
Ich fragte, warum denn auf einmal.
Es gibt keine Mittel für Tests. Nicht mal für ihn stehen Gelder bereit, um sich testen zu lassen. Wenigstens auf Antikörper. Er sei ratlos, auch den Hauptamtlichen gegenüber. Wir messen unsere Körpertemperaturen. Ein Suchtkranker sieht das als Schwäche. Sagte er. Da geht er lieber zurück in den Knast.
Sechzig Klienten hat er zu versorgen. Die Psychiatrien nehmen keinen mehr auf. Im Gegenteil. Sie brechen die Therapien ab und schicken mir Klienten. Ich finde nicht einen einzigen Psychiater, der eine Einweisung unterschreiben würde. Solange keine Erkrankung mit Symptomen diagnostiziert wird, geschieht nichts.
Drei Verdachtsfälle auf Infizierung halte er in der Einrichtung unter Quarantäne. Vierzehn Tage in ihre Zimmer eingesperrt. Das Essen vor die Tür gestellt. Sie kriegen keinen Menschen mehr zu Gesicht. Wir haben jedem ein Telefon ins Zimmer gestellt, damit er mit seinem Betreuer kommunizieren kann. Durch die geschlossene Tür zu kommunizieren, ist noch unwürdiger.
Ich habe abgesagt.
Aus Verlegenheit oder einfach, um einen guten, unverbindlichen Schluss zu finden, sprachen wir über eine Veranstaltung vom Vortag.
Dieser von allen verlassene Mann begann von der Pressekonferenz des Bundesministers für Gesundheit und der vier Ministerpräsidenten der Länder zu berichten. Alle Fünf ordentlich auf Abstand platziert. Nicht ein einziger Fragesteller im Saal. Eine Kamera, und eine zweite, die zur Abwechslung den Kameramann der ersten gezeigt hat. Die Fragen der Journalisten habe eine Frauenstimme aus dem Off vorgelesen.
Die Frohe Botschaft habe gelautet: Wir haben alles im Griff. Immer wieder: Wir haben alles im Griff. Immer mit einer Geste zu seinen Mitstreitern hin rechts und links an seiner Seite, die ihm Zustimmung genickt haben. Der Minister hat sich zuletzt bei den abwesenden Fragestellern bedankt, dass sie anwesend gewesen seien. Er hat sich auch im Namen seiner Ministerpräsidenten verabschiedet.
Und dann sei passiert, was diesen bedächtigen Leiter einer Einrichtung zur Wiedereingliederung von Suchtkranken und Wohnungslosen in die Gesellschaft aus der Fassung gebracht hat. Die fünf Helden sind zusammengestanden und haben sich per Handschlag voneinander verabschiedet. Sich schulterklopfend zum Gelingen beglückwünscht. Der Ton war schon abgeschaltet. Die Kameras seien noch gelaufen.
Römische Legionäre haben den dornengekrönten Menschensohn nicht menschenverachtender mit Hohn und Spott überhäufen können, als dieses Minister-Quintett. In diesem Moment habe er die Metapher seiner Religion in ihrer ganzen furchtbaren Wahrheit erkannt.
Noch ein letztes Wort.
In zehn Jahren werde seine Einrichtung die Kinder nicht fassen können, die heute in der Solidarischen Isolation leben müssen. Dass sie als Vierjährige durch eine Isolationshaft gegangen sind, dafür übernimmt keiner die Verantwortung.
Gelegentlich noch nehme ich den 31er oder die 24. An unserer Haltestelle wirbt das Land BW für sich und seine Dynamik. Bei uns dreht sich alles um Sie! Um Ihre Mobilität. BW bwegt! Junge Leute feiern ihre Sprunggelenke. Politik ist ein Tanker, der sich nicht stoppen lässt. Irgendein Entscheider in der Landesregierung hat diesen Unsinn plakatieren lassen. Niemand außer mir ist da, um es zu lesen. Denn WirBleibenZuhause!Kapitel 24: ZooEinen guten Speerwurf weit liegen Botanischer Garten und Tiergarten auseinander. Von der Höhe des Prellsteins sehe ich die höchsten Erhebungen des Alpinums im Botanischen Garten. Und im Vorgarten des Zoos die lungernden Bären. Ihr Fell ist strapaziert wie eine Skipiste im Sommer.
Der Tiergarten verdankt seinen Standort den Hochwassern. Dem Neuen Zentralfriedhof (sic!) draußen vor der Stadt wurden die Särge aus den Gräbern gerissen und in den Fluss geschwemmt. Nach zwei Saisonen war dieser Spuk vorbei. An seiner Stelle befindet sich jetzt der Zoo.
Der Zoo hat einen Affen. Einen riesigen grotesken Affen, eine abstoßend strotzende Kreatur mit haarlosem Hautsack und einem leuchtend roten Hinterteil. Die Kinder bleiben fasziniert stehen, die Männer gehen schnell weiter, und die Frauen versuchen herauszufinden, an wen er sie erinnert. Sein Name ist Urian. Lord und Gentleman Urian.
Lord Urian ist schon in Radio und Fernsehen aufgetreten. Das Urian-Pfeifkonzert liegt ihm Zoo Shop als CD für Sie bereit.
Seine Dick-Madame, Lady Griselle, ist eine berühmte Künstlerin, eine begnadete Malerin, ihre Werke erzielen höchste Preise! Ausgesuchte Unikate werden auf einer Vorbesichtigung in der Zoo Galerie gezeigt. Sie können telefonisch oder per E-Mail Ihr Gebot abgeben. Simsen Sie ihr Gebot. Letzte Bietmöglichkeit ist Donnerstag, der 7. Mai, 12 Uhr. Das höchste Gebot ist mit einem besonderen Privileg verbunden: Eine Malstunde mit Griselle.
Der Erlös ist für einen guten Zweck gedacht. Das Affengehege soll größer werden. Es lohnt sich. Kommen Sie! Lassen auch Sie sich von Lord Urian und Lady Griselle verzaubern. Werden Sie ihre Bewunderer.
Diese Aktion ist abgesagt.
Einen Speerwurf weit liegen Botanischer Garten und Tiergarten auseinander. Der Zoo hat sich überlebt. Der Botanische Garten hat ausgedient. Wer exotische Tiere sehen will, fliegt nach Afrika. Die Botaniker brauchen keinen Pflanzengarten mehr. Ihre Forschung findet im Labor statt.
Wie es den andern geht?
Müsste schon sehr wollen und genau hinschauen.
Gerade dort, wo es immer lebhaft war, ist es richtig gespenstisch. Das Ehepaar kampiert mit Hab und Gut unter dem Vorbau vor der Cafeteria. Auf dem Präsentierteller. Aber es kommt niemand mehr, dem sich präsentieren ließe. Sie scheint nichts zu irritieren. Die Gerüste des städtischen Literatur-Frühlings sind halb aufgeschlagen. Stehen auf dem Platz zwischen der Alten und Neuen Uni als Ruine. Nicht mal die Zelte abzubauen ist erlaubt. Eigentlich ein Paradies der Kinder der Altstadt. Sie sind nicht zu sehen. Manchmal sitzt der Straßenmaler bei ihnen. Und ein Neuer, den ich nicht kenne. Unter denen, die auf der Straße leben.
Zur Heimfahrt bereit stehe ich an der Haltestelle und warte auf den 31er. Wollte nur mal kurz vorbeischauen, was geht, und was nicht. Der Fahrer des 33er kommt ans Fenster und berichtet seinem Kollegen. Er hatte zwei Fahrgäste ins Zentrum. Jetzt fährt er seinen gastlosen Gelenkbus durch die Stadt.
Den schüchternen weißhaarigen Hänfling sehe ich vorm TeGut-Supermarkt. Wir vermissen beide unsere Cafeteria. Der Ausrufer mit der Straßen-Zeitung mault mit mir, als würde er mich hassen dafür, dass er mir nichts mehr auszurufen hat. Der, den wir Professor nennen, sitzt in der Morgensonne vorm Mathematikon. Ich gehe drei Schritte auf ihn zu.
"Uns fehlt die Cafeteria."
Er blickt auf, lächelt und nickt. Das erste Mal, dass er mich anschaut. Seine Bank steht bis zum Mittag in der Sonne. Ich bewundere ihn und die andern, die ein neues Plätzchen gefunden haben. Die Welt ist leer. Die Stadt gehört dem Virus. Langsam rollt ein Mercedes vorbei. Unhörbar, als fahre die deutsche Polizei einen Tesla.
Die Bebauung der Felder - Von Herbert Kollenz
Meist gelesen |
Zuletzt kommentiert |
Meist kommentiert
Bierhelderhof:
Warum einer der schönsten Biergärten Heidelbergs geschlossen ist
Leimen:
Beim VfB fehlen 93.000 Euro - wo blieb das Geld aus dem Klubhaus?
Meckesheim:
Hundesteuer steigt für Listenhunde auf 600 Euro
Kurioses Video:
Bis der Bammentaler Bademeister brüllt
Ladenburg:
Wie Moritz zum beliebten "Platz-Kater" am Edeka-Markt wurde
Schmieder-Klinik Heidelberg:
Wie Long-Covid die Reha-Behandlung erfasst
Heidelberg:
Naturschützer gegen Abstellanlage am Ochsenkopf
Heidelberg:
Neckarstaden-Baustelle blockiert Gehweg
Kurioses Video:
Bis der Bammentaler Bademeister brüllt
Schmieder-Klinik Heidelberg:
Wie Long-Covid die Reha-Behandlung erfasst
Heidelberg:
Neckarstaden-Baustelle blockiert Gehweg
Heidelberg:
Naturschützer gegen Abstellanlage am Ochsenkopf
Heidelberg:
Wie der Architekt den Streit um den "Riesenklotz" einordnet
SV Sandhausen:
Kein Corona-Fall unter 3500 Fußballfans
Rainbach-Pläne:
Investor ändert Planung vor Bürgerentscheid Ende September
Sinsheim:
Fahrgastzahlen liegen noch unter Vor-Corona-Niveau
Reinbach-Pläne:
Bürgerinitiative kritisiert in schwarzer Kleidung
"Heidelberg Cement"-Blockade:
Vier Klima-Aktivisten müssen vor Gericht
Bierhelderhof:
Warum einer der schönsten Biergärten Heidelbergs geschlossen ist
Polizei stoppt Hähnchenwagen:
Rostige Achse, gammeliges Fleisch
Kurioses Video:
Wie Jesus in Bammental übers Wasser lief (plus Video)
Corona-Ticker Neckar-Odenwald:
Inzidenz steigt auf 12,5 (Update)
Corona-Ticker Baden-Württemberg:
Inzidenz-Zahlen steigen in der gesamten Region (Update)
Raubüberfall in Sinsheim:
Nach dem Raubüberfall fielen weitere Schüsse (Update)
A5 bei Weiterstadt:
Autofahrer raste mit über 150 km/h in die Tankstelle (Update)
A81 bei Ilsfeld:
Geisterfahrer wird auf der Autobahn überfahren
A6 bei Heilbronn:
Rettungsgasse rettet Hundewelpen das Leben
"Deja Camper" Bruchsal:
Sie ist mit fast 20 Jahren ins Camper-Geschäft eingestiegen