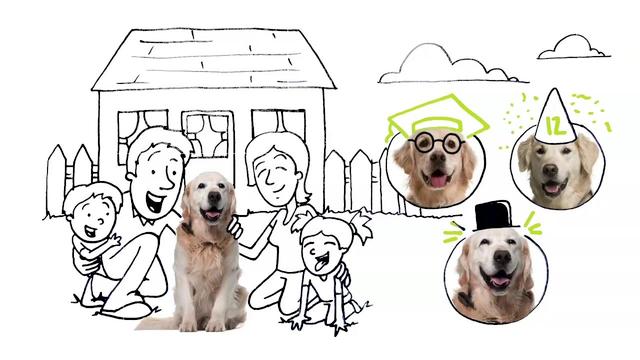Die wissenschaftliche und politische Dimension der Frage, ob immer mehr Menschen psychisch gestört sind
An der Frage, ob psychische Störungen zunehmen, gleich bleiben oder gar abnehmen, scheiden sich die Geister. Die Einen argumentieren gesellschaftskritisch, dass die heutige Zeit mit ihren Veränderungen der Arbeitswelt, der Medien und ihren Krisen die Menschen krank mache. Die Anderen halten das für Kulturpessimismus, den es schon immer gegeben habe, und zeichnen ein positives Bild der Gegenwart.
Unstrittig ist, dass immer mehr Menschen wegen psychisch-psychiatrischer Probleme behandelt werden. Während die Vertreter aus dem kritischen Lager dies als Bestätigung werten, winken die Optimisten ab: Das liege bloß an der größeren Aufmerksamkeit für das Seelenwohl und an veränderten Diagnosegewohnheiten. Beide Seiten berufen sich auf wissenschaftliche und gesellschaftliche Daten. Wer hat Recht?
Politik und Gesundheit
Es handelt sich hier um keine rein akademische Debatte. Vielmehr schwingt eine soziopolitische Komponente nicht nur mit, sondern steht sogar im Mittelpunkt: Wenn die heutigen Verhältnisse viele Menschen krank machen, dann sollte man sie ändern. Hier sei einmal an den Psychoanalytiker und Philosophen Erich Fromm (1900-1980) erinnert, der in Entwicklungen wie Entfremdung oder Massenkonsum pathologische Kräfte sah (etwa “Haben oder Sein”, 1976) und sich gegen eine Sozialwissenschaft stellte, die den Menschen für beliebig anpassbar hielt.
Wenn die Menschen hingegen gut mit den Veränderungen der letzten Jahrzehnte leben können, man denke an Globalisierung und Neoliberalismus, dann spricht viel für diese; dann gibt es auch kaum Gründe für Beschwerden oder die Ablehnung des Status quo. Es geht also um reformerische gegenüber konservativen Tendenzen, die aus den Tatsachen über das Wohlbefinden der Menschen abgeleitet werden.
Wer gilt als psychisch gestört?
Ich schrieb hier schon einmal 2012 über neue epidemiologische Forschung – also Forschung über die Häufigkeit psychischer Störungen –, die zu dem Ergebnis kam, dass fast die Hälfte der Menschen in Europa Jahr für Jahr mindestens einmal eine psychische Störung hat (Beinahe jede(r) Zweite gilt als psychisch gestört). Das klinkt nach viel und wirft das theoretische Problem auf, dass die Störungen eigentlich vom Normalzustand abgegrenzt werden sollen. Wenn es aber schon normal ist, so eine Störung zu haben, sind dann vielleicht die nicht-gestörten die Abnormalen?
Psychische Störungen kommen häufig vor und bedeuten für die Betroffenen meistens großes Leid. Am häufigsten sind Angststörungen, Schlafstörungen, Depressionen und Aufmerksamkeitsstörungen. Bildquelle: PDPics, Lizenz: CC0
Dieses bis heute ungelöste Problem wurde bereits 1881/1882 in einer Folge von Kurzgeschichten, später erschien sie unter dem Titel “Der Psychiater” als Novelle, von dem brasilianischen Autor Joaquim Maria Machado de Assis (1839-1908) behandelt. Mir ist nur eine englische Übersetzung bekannt. Die Erzählung hat in den mehr als 130 Jahren aber nichts von ihrer Aktualität und Skurrilität eingebüßt und eignet sich auch hervorragend als Unterrichtsmaterial. Für Ärzte und Psychotherapeuten sollte sie Pflichtlektüre sein.
Sind 40, 45 oder 50% viel?
Bleiben wir aber bei der Frage, ob es viel ist, wenn 40, 45 oder gar 50% der Bevölkerung Jahr für Jahr an mindestens einer psychischen Störung leiden sollen? Zur Erinnerung: Die Spannweite der Schätzung ergab sich daraus, dass der epidemiologische Befund zur Häufigkeit (38%) auf der Untersuchung von nur 27 der häufigsten Störungen beruhte. Man kann aber mehrere Hundert davon unterscheiden. Das wäre in den ohnehin schon sehr komplexen Studien jedoch nicht mehr handhabbar.
Hier ist noch einmal ein historischer Rückblick hilfreich, wenn auch nicht so weit wie im Falle des brasilianischen Autors: Einer der Meilensteine bei der Erforschung der Häufigkeit psychischer Störungen war die in den 1950er Jahren in Manhattan durchgeführte und 1962 erschienene Studie “Mental Health in the Metropolis”, deren Titel wohl nicht zufällig an den berühmten Aufsatz “Die Großstädte und das Geistesleben” Georg Simmels aus dem Jahr 1903 erinnerte.
Die Manhattan-Studie über das Seelenleben der Großstädter, die auf knapp 2000 repräsentativen Interviews beruhte, wurde dann auch dahingehend zitiert, dass rund 80% der Stadtbewohner psychische Probleme hätten. Kritiker der Landflucht fühlten sich bestätigt: Der Mensch sei eben doch für die Natur, die Dörfer und allenfalls Kleinstädte geschaffen.
Eine Frage der Grenzziehung
Die Sache hatte nur einen Haken: Auf die Zahl, genauer: auf die 81,5% kommt man nur, wenn man ausschließlich die 18,5% der Befragten, die überhaupt keine Probleme angaben, als psychisch gesund ansieht. Die Forscher von der Cornell University in New York, die die großangelegte Studie durchführten, hatten die Symptomstärke der Menschen auf einer Skala von 0 bis 6 eingeordnet. Wo soll man die Grenze ziehen?
Wenn man es nicht zwischen 0 und 1 tut, wie es damals häufig gemacht wurde, sondern beispielsweise zwischen 2 und 3, dann gelten plötzlich nur noch rund ein Viertel der Großstadtmenschen als psychisch gestört. 81,5 oder 23,4% – beide Mal geht es um dieselbe Studie, dieselben Menschen, dieselben Daten.
Es gibt kein ehernes Gesetz, aus dem sich eine eindeutige Antwort ableiten ließe. Man sollte nur transparent mit seiner Grenzziehung umgehen und die Begründung dafür mitliefern. Das gilt im Übrigen für die Berichterstattung für heute genauso wie die von damals.
Was sind psychische Störungen?
Der heutige Konsens für die Definition einer psychischen Störung, sozusagen die “amtliche” Fassung, besteht in einer “klinisch signifikanten Störung des Denkens, der Emotionsregulation oder des Verhaltens ..., [die] üblicherweise mit signifikantem Leiden oder signifikanter Einschränkung in sozialen, beruflichen oder anderen wichtigen Aktivitäten” einhergeht (Die “amtliche” Fassung). Das stammt aus dem Grundlagenteil des Diagnosehandbuchs der nordamerikanischen Psychiater, das 2013 in seiner bisher fünften Auflage erschien und weltweiten Einfluss hat.
Das eigentümliche an dieser Definition ist, dass das am häufigsten vorkommende Wort “signifikant” nirgendwo eindeutig bestimmt ist. Man kennt es aus der Statistik. Aber auch dort muss man das Signifikanzniveau erst festlegen. Man muss also eine Norm einführen, um unter der Fragestellung zufällig aussehende von nicht-zufällig aussehenden Mustern zu unterscheiden. Kurzum, wenn der Duden “signifikant” als “in deutlicher Weise als wesentlich, wichtig, erheblich erkennbar” beschreibt, dann ist das gar nicht verkehrt.
Klinischer Blick auf den Menschen
Es liegt dann aber auch auf der Hand, dass die Feststellung, ob die psychischen Probleme einer Person in dieser Weise “signifikant” sind, an der Einschätzung durch den klinischen Experten liegt. Dafür ist er idealerweise geschult und verfügt er auch über einen Erfahrungsschatz. Dazu kommen kulturelle Prägung und soziale Erwartungen.
Jemand, der trotz Schicksalsschlägen von hiobschem Ausmaß über kein Leid klagt, aktiv Freundschaften pflegt, geregelt einer Arbeit nachgeht und Hobbys hat, wird üblicherweise vom Psychotherapeuten oder Psychiater keine Diagnose erhalten. Fachleute würden dann eher von einer hohen Resilienz, also Widerstandskraft dieser Person reden.
Wer aber durch Arbeitslosigkeit in ein Loch fällt, sich immer weiter zurückzieht, vor Angst nicht mehr aus dem Haus geht, den Kontakt mit immer mehr Menschen abbricht und exzessiv trinkt, um permanente Gefühle von Wertlosigkeit zu unterdrücken, der dürfte wohl doch eine Diagnose erhalten. Zwischen solchen relativ klaren Fällen liegt ein ganzes Spektrum von Variationen, das eben so reich und vielfältig ist, wie unsere Menschenwelt.
Der Blick des Epidemiologen
So viel zum Grundlagenwissen, worum es in einem klinisch-diagnostischen Gespräch mit einem Psychiater oder Psychotherapeuten geht. Nun muss man wissen, dass die Methoden der Epidemiologen versuchen, so ein individuelles Gespräch in eine standardisierte Form zu bringen, die sich einem Stab von Hilfskräften beibringen lässt.
Diese ziehen dann durch die Lande und befragen, wie in der zitierten Studie mit den 40%, tausende Menschen. Wohlgemerkt, der Arzt oder Psychologe will feststellen, wie es dem einzelnen Patienten geht; der Epidemiologe will Daten erheben, wie verbreitet Störungsbilder in der ganzen Gesellschaft sind.
Der geneigte Leser kann hier dem Harvard-Professor Ronald Kessler dabei zuhören, wie er die Geschichte der psychiatrischen Epidemiologie kurz zusammenfasst: Von Zeiten, in denen Forscher in Dörfern die Dorfältesten, Bürgermeister oder Polizisten nach auffälligen Menschen fragten, die dann näher untersucht wurden. Das lieferte natürlich stark verzerrte Ergebnisse.
Danach kamen die Einstellungs- und Auswahltests, die während der beiden Weltkriege militärischen Zwecken dienten. Schließlich entstanden die koordinierten Verfahren der Weltgesundheitsorganisation (WHO), die in den 1980er, 1990er und frühen 2000er Jahren entwickelt wurden und bis heute den Stand der Forschung bestimmen.
Die Mär vom Schnupfen
Epidemiologen selbst relativieren ihre eigenen Zahlen übrigens bisweilen mit dem Hinweis, psychische Störungen seien eben so wie ein Schnupfen. Daher wären die 40% auch nicht viel. Das ist aber insofern ein schiefer Vergleich, als bei den Störungen ein deutliches Leiden oder eine erhebliche Einschränkung des Lebens vorliegen sollte, wie wir oben gesehen haben.
Eine Nebenbemerkung zum Schnupfen: Die Geschichte, Depressionen seien ein “Schnupfen der Seele”, haben sich gewiefte Werbeleute der Pharmaindustrie ausgedacht, als sie ihre Produkte in Japan verkaufen wollten. Dort waren vor den 2000ern Psychopharmaka verpönt. Ethan Watters beschrieb in seinem Buch “Crazy Like Us: The Globalization of the American Psyche” (2011), wie Pharma-Giganten wie GlaxoSmithKline Befunde der Anthropologie und transkulturellen Psychiatrie verwendeten, um den japanischen Markt zu erobern.
Und die Mär von den Rückenschmerzen
Ein Beispiel, um das es hier zum Jahreswechsel schon einmal ging, ist Ulrich Hegerl, Direktor der Universitätsklinik für Psychiatrie und Psychotherapie in Leipzig und seit 2008 Vorsitzender der Stiftung Deutsche Depressionshilfe. Die Stiftung verbreitet Informationen zum Thema Depressionen und betont dabei die Bedeutung genetischer Faktoren und pharmakologischer Behandlungen (Was sind Ursachen von Depressionen?).
Hegerl vertritt den Standpunkt, der Anstieg der Häufigkeit bei der Diagnose psychischer Störungen wie den Depressionen rühre daher, dass früher psychische Probleme eher als körperliche Erkrankungen diagnostiziert worden seien, vor allem als Rückenschmerzen. Damit stellt er sich auf die Seite der eingangs erwähnten Optimisten, die den Status quo verteidigen: Die heutigen Lebensumstände machten die Menschen nicht kranker als früher, sondern die Probleme würden nun anders und sogar besser beschrieben.
Immer mehr Rückenschmerzen
Das von Hegerl und vielen anderen führenden Psychiatern angeführte Argument überzeugt aber schon deshalb nicht, weil laut einer Studie des Robert-Koch-Instituts auch die Häufigkeit von Rückenschmerzen – die über mindestens drei Monate fast täglich auftreten – gestiegen ist. Auch der neueste DAK Gesundheitsreport von 2018 widmete sich dem Schwerpunktthema Rückenerkrankungen, weil diese nach wie vor so viele Arbeitsunfähigkeitstage verursachen.
Gaben 2003 noch rund 55% der Befragten an, innerhalb der letzten zwölf Monate Rückenschmerzen gehabt zu haben, waren es 2017 schon 75%. Die Anzahl der Krankenhausbehandlungen ist laut dem Bericht gar um 80% gestiegen. Man kann also den teilweise dramatischen Anstieg bei den psychologisch-psychiatrischen Diagnosen der letzten Jahre nicht mit dem Verweis auf falsch diagnostizierte Rückenschmerzen wegerklären.
Das zeigt auch ein Blick auf die Frühberentungen: Die nahmen im Zeitraum von 2006 bis 2015 für die Muskel- und Skeletterkrankungen zwar von rund 26.500 auf 21.500 pro Jahr ab. Das erklärt aber bei weitem nicht den Anstieg bei den psychischen Störungen von 51.500 auf 74.000 pro Jahr im selben Zeitraum. Einer Abnahme von 4.000 steht also eine Zunahme von mehr als 22.000 Fällen pro Jahr gegenüber (Mehr über Ursachen von Depressionen).
Kapitalismus und Depressionen
Sehr deutlich auf die Seite der Verteidiger des Status quo stellte sich auch der Soziologe, Psychologe und Psychotherapeut Martin Dornes, Wissenschaftler am Frankfurter Institut für Sozialforschung. In der ZEIT versuchte er zusammen mit einem Kollegen den Nachweis, dass der Kapitalismus die Menschen nicht depressiv mache.
Kurz darauf veröffentlichte er ein Buch zum Thema (“Macht der Kapitalismus depressiv? Über seelische Gesundheit und Krankheit in modernen Gesellschaften”, 2016), in dem er seine Argumentation weiter ausführt. Die FAZ richtete daraufhin ein Streitgespräch zwischen ihm und dem Jenenser Soziologieprofessor Hartmut Rosa ein.
Rosa behauptete darin, der Kapitalismus führe zu mehr Burnout und Depressionen. Dornes zufolge geht es uns aber so gut wie nie. Deutlicher können sich zwei Standpunkte kaum voneinander unterscheiden.
Kapitalismuskritik seit dem “erschöpften Selbst”
Dornes’ Buch ist eine gute Vorlage, rechnet er dort doch mit zahlreichen Kapitalismuskritikern ab, die seit dem Buch “Das erschöpfte Selbst” (1998; deutsch 2004) des französischen Soziologen Alain Ehrenberg auf psychische Störungen allgemein und Depressionen im Besonderen hinweisen. Und die Frage nach den möglichen gesellschaftlichen Ursachen kommt Jahr für Jahr aufs Neue auf, wenn Krankenkassen wieder einen Anstieg der psychologisch-psychiatrischen Diagnosen berichten (Diagnosen psychischer Störungen steigen stark an).
Martin Dornes fasst erst einmal seitenlang den Stand der epidemiologischen Forschung zusammen und kommt zu dem Ergebnis, dass diese im Laufe der Zeit keinen Anstieg psychischer Störungen dokumentiert. Damit fehle es der These, durch den sich weltweit ausbreitenden Kapitalismus gehe es den Menschen psychisch schlechter, schon einmal an Untermauerung:

“Echte” und “unechte” Störungen
Hier handelt sich der Autor gleich zwei Probleme ein, die sich durchs ganze Buch und damit seine Argumentation für den Kapitalismus ziehen: Einerseits grenzt er die “echten” von den “gefühlten” oder “diagnostizierten” psychischen Störungen ab. In diesem Zusammenhang spricht er auch gerne von der “Realprävalenz”, also wörtlich der “echten Häufigkeit” psychischer Störungen. Und diese wüssten eben allein die Epidemiologen.
Andererseits übersieht er, dass die von ihm wegen ihres wissenschaftlichen Vorgehens so gelobten Epidemiologen natürlich auch die Kriterien der diagnostischen Manuale verwenden. Was sollten sie auch sonst in der Breite erheben, wenn nicht die allgemein anerkannten Definitionen psychischer Störungen?
Gibt es immer mehr Störungsbilder?
Konkret führt Dornes hier aus, das amerikanische DSM von 1952 habe 106 Störungen umfasst, die Ausgabe von 1968 schon 188, die von 1980 265, die von 1994 297 und schließlich die neueste von 2013 400. Er übersieht hierbei aber, dass diese Zahlen davon abhängen, wie man zählt.
So führte Robert McCarron von der University of California in Davis zum Beispiel aus, zwischen der vierten und der fünften Ausgabe, also von 1994 bis 2013, sei die Anzahl der Störungen von 172 auf 152 gefallen. Der Psychiatrieprofessor Nassir Ghaemi zählte in der neuesten Fassung 265, der Psychiater James Morrison kam gar auf 155 bis 600. Wie kann das sein?
Leider herrscht keine Einigkeit darüber, was man als eigene Störung zählen sollte und was nicht. Ist eine milde neurokognitive Störung (Mild Neurocognitive Disorder, 2013 neu aufgenommen) etwas prinzipiell Anderes als eine starke neurogkognitive Störung (Major Neurocognitive Disorder) – oder bloß eine Variante? Sollen einmalig auftretende depressive Episoden zusammen oder getrennt von der depressiven Störung gezählt werden?
Probleme der Epidemiologie
Wie dem auch sei – so oder so wird für Dornes kein Argument daraus: Wenn die Anzahl der Diagnosen steigt, weil Anzahl der Störungen steigt, dann sollten nämlich auch die epidemiologisch erhobenen Störungen steigen. Der Autor behauptet aber gerade, dass sie das nicht tun.
Später im Buch fällt ihm dieser Widerspruch auch auf. Das veranlasst ihn aber nicht zum Überdenken seiner Schlussfolgerung, sondern zu der rein spekulativen Behauptung, dann müsste die echte Häufigkeit psychischer Störungen eben abgenommen haben.
Korrekt wäre hier der Hinweis gewesen, dass die epidemiologischen Studien sowieso immer nur eine kleine Auswahl aller möglichen Störungen untersuchen. Bei der oben erwähnten mit den 40% waren es 27 der am häufigsten vorkommenden. Und das ist für eine einzelne Untersuchung schon recht viel! Dabei gilt freilich, dass eine Studie eine größere Häufigkeit ergeben kann, je mehr Störungen sie erfasst.
Dornes hätte hier mindestens zeigen müssen, dass der erhebliche Anstieg bei den Diagnosen durch die neu geschaffenen Störungen entsteht. Tatsächlich sind es aber eher “Klassiker” wie Depressionen, Angst-, Schlaf- oder Aufmerksamkeitsstörungen (30 Jahre Aufmerksamkeitsstörung ADHS), auf die die meisten Diagnosen fallen.
Psychologischer Essenzialismus
Das bildet auch schon den ersten großen Riss in Martin Dornes’ argumentatorischem Gefüge: Die Ergebnisse epidemiologischer Studien hängen entscheidend davon ab, wie die entsprechenden Forscher messen. In der wiederholten Redeweise von der “Realprävalenz” äußert sich bei Dornes aber ein Essenzialismus, der dem Thema der psychischen Störungen überhaupt nicht gerecht wird.
Niemand weiß, was die “echten” und was die “unechten” Störungen sind. Alle paar Jahre kommen neue hinzu – sind die echt? – und verschwinden andere wieder – waren die unecht? Wie wir gesehen haben, sind sich Fachleute nicht einmal einig darüber, wie man deren Anzahl im Diagnosehandbuch zählen sollte. Dornes tut so, als handle es sich bei psychischen Störungen um Elemente des Periodensystems.
Da kommen zwar gelegentlich auch neue hinzu, die sind aber klar definiert – nämlich über ihre Protonenzahl. Sie verschwinden auch nicht einfach wieder von der Liste, wenn Experten das nach zehn bis fünfzehn Jahren am Konferenztisch entscheiden. Frei nach dem Motto: “Wir dachten immer, Eisen habe 26 Protonen, dabei war das Silber. Und nach neueren Überlegungen kommen wir zu dem Ergebnis, dass es Phosphor gar nicht gibt.” Zu guter Letzt sind sie sich auch nicht uneins darüber, ob nun 50, 118 oder 300 verschiedene Elemente darauf abgebildet sind.
Tatsachen auf dem Kopf
Viel grundlegender ist aber das Missverständnis der Materie, das sich in Dornes Unterscheidung zwischen “echten” psychischen Störungen auf der einen Seite und “gefühlten” sowie “diagnostizierten” auf der anderen Seite äußert. Kann man etwa depressive Symptome nur “fühlen”, ohne sie wirklich zu haben? Und wenn ein Arzt oder Psychotherapeut diese nach den Regeln des Fachs feststellt und eine depressive Störung diagnostiziert, ist die dann nicht “echt”, sondern nur “diagnostiziert”?
Der Autor stellt tatsächlich im ganzen Buch die Tatsachen auf den Kopf, wo er davon ausgeht, wir bräuchten die epidemiologischen Untersuchungen zur Bestätigung der klinischen Diagnosen. Korrekt ist es gerade umgekehrt, dass Epidemiologen mit ihren Methoden versuchen, die Vorgänge eines klinischen Gesprächs näherungsweise so abzubilden und zu standardisieren, dass sie massenweise durchgeführt werden können – eben für repräsentative Erhebungen in ganzen Gesellschaften.
Diagnostisches Gespräch gilt als der Standard
Stellen wir uns einmal vor, eine Person bekommt vom Psychiater eine Angststörung diagnostiziert. Einen Tag später kommt zufällig die Hilfskraft eines Epidemiologen vorbei, liest den standardisierten Fragebogen vor, gibt die Ergebnisse in einen Computer ein und dieser berechnet das Ergebnis: keine Störung. Ist dann die Angststörung dieser Person nicht “echt”, sondern nur “gefühlt” oder “diagnostiziert”? Natürlich nicht.
Tatsächlich haben Epidemiologen wie der bereits erwähnte Ronald Kessler oder der Dresdner Professor Hans-Ulrich Wittchen in jahrzehntelanger Grundlagenforschung überprüft, ob ihre standardisierten Fragebögen zu denselben Ergebnissen führen wie klinisch-diagnostische Interviews. Eine einschlägige Studie ergab, dass die Übereinstimmung für verschiedene Störungen zwischen 62% und 93% liegt.
Wenn man also zwischen “echten” und “unechten” Störungen unterscheiden wollte, dann wäre die Richtung gerade das Gegenteil von dem, was Dornes unterstellt: Die klinische Diagnose steht über dem epidemiologischen Fragebogen. Das ist auch nicht überraschend, da der Kliniker nicht nur viel besser ausgebildet ist als die Hilfskraft des Epidemiologen, sondern auch viel mehr Möglichkeiten hat, auf die konkrete Situation seines Patienten einzugehen.
Eigenarten der Stichprobenforschung
Zudem sind sich die Epidemiologen der Tatsachen bewusst, dass ihre Fragen von den Personen der Allgemeinbevölkerung missverstanden werden können und ihre Verfahren andere Fehlerquellen aufweisen. Dass sich die so Befragten oft an das Vorliegen bestimmter Symptome innerhalb der letzten zwölf Monate oder noch längerer Zeiträume erinnern sollen, garantiert auch nicht die sichersten Ergebnisse.
Dieser Punkt macht einen weiteren grundlegenden Unterschied zwischen Epidemiologie und klinischer Diagnostik deutlich, den Dornes nicht einmal erwähnt: Die Hilfskräfte der Epidemiologen kommen für ihre repräsentativen Erhebungen ungefragt, während psychologisch-psychiatrische Patienten, einmal von Zwangseinweisungen abgesehen, auf eigene Initiative zum Arzt oder Psychotherapeuten kommen. Das heißt, wer diesen Schritt unternimmt, der hat bereits ein Hilfsbedürfnis; bei wem angerufen oder geklingelt wird, hat vielleicht gar keins.
Das führt uns noch einmal zurück zu den 40%, nach dornescher Lesart die “Realprävalenz” psychischer Störungen für einen Zwölfmonatszeitraum in einem europäischen Land. Dass der Autor auch andere Zahlen zitiert, weil andere Studien anders methodisch vorgegangen sind, steht dahin.
Droht Gesundheitssystemen das Aus?
Wenn wir jetzt die 40% epidemiologisch erhobenen psychischen Störungen so auffassen, wie sie in den Diagnosehandbüchern der Ärzte und Psychotherapeuten gemeint sind – nämlich als Ausdruck wesentlichen Leidens oder erheblicher Einschränkungen des Lebens – dann steht das Gesundheitssystem aller Länder vor einer Katastrophe: So viele Menschen können nämlich nirgendwo behandelt werden. Zum Glück müssen sie es aber auch gar nicht.
Noch einmal langsam: Die Hilfskräfte der Epidemiologen stellen repräsentativ ausgewählten Menschen fragen dazu, ob sie sich an diese oder jene Symptome erinnern. Die meisten dieser Personen wären von sich aus nie auf die Idee gekommen, deswegen zum Arzt oder Psychotherapeuten zu gehen. Viele kommen auch so gut mit ihrem Leben zurecht. Sie haben schlicht kein Hilfsbedürfnis.
Dass manche Menschen und leider häufiger gerade diejenigen, die am meisten Hilfe brauchen, sich aus eigenem Antrieb nicht dazu aufmachen, ist ein trauriger Aspekt des Behandlungsalltags. Wenn man hier weiter gehen wollte als die heutigen Bewusstseins- und Aufklärungskampagnen es tun, dann müsste man wohl alle Menschen zwangsweise einer Befragung unterziehen. Neben der Einschränkung der Freiheit geschähe das dann aber um den Preis zahlreicher falsch-positiver Fälle.
Niedrige Behandlungsrate
Auf welches Glatteis man sich begibt, wenn man der Redeweise von der “Realprävalenz” folgt, ergibt sich noch aus einer anderen Überlegung: Wie wir gesehen haben, sind psychische Störungen ihrer Definition nach erheblich, also nicht bloß ein Schnupfen. Wenn nun 40% der Allgemeinbevölkerung Jahr für Jahr solche erheblichen Probleme haben, warum entfallen dann etwa laut DAK Gesundheitsreport 2018 auf jeden Versicherten im Schnitt nur 2,5 Arbeitsunfähigkeitstage pro Jahr? Dass das aus anderem Blickwinkel recht viel ist, darauf komme ich gleich noch.
Bleiben wir aber bei noch einen Moment bei den Epidemiologen: Die stellen fest, dass psychische Störungen so häufig sind wie ein Schnupfen. Nun muss man wissen, dass deren Symptome in der Regel Wochen oder gar Monate vorliegen müssen, damit die Diagnosekriterien erfüllt sind. Warum fehlen die Menschen dann aber im Mittel nur 2,5 Tage im Jahr wegen psychischer Störungen am Arbeitsplatz?
Es passt also hinten und vorne nicht, zu sagen: Die 40% sind die Realprävalenz, so häufig sind psychische Störungen wirklich, das ist die Antwort der harten Wissenschaft, solche Menschen leiden also jährlich erheblich oder sind wesentlich in ihrem Leben eingeschränkt – und doch fehlen sie kaum am Arbeitsplatz.
Nur 16% in Behandlung
Auch aus einer anderen Richtung kommt man zur selben Schlussfolgerung: Die epidemiologischen Studien erheben häufig mit, ob die Befragten professionelle Hilfe suchen. So hat beispielsweise der amerikanische Psychiatrieprofessor Randy Auerbach kürzlich mit Kollegen aus zahlreichen Ländern die psychische Gesundheit von Studierenden untersucht.
Im Ergebnis hatten rund 20% der Befragten mindestens eine psychische Störung innerhalb des letzten Jahres. Nur nebenbei, um Spekulationen über das Hochschulwesen vorzubeugen: Rund 83% dieser Personen hatten schon vor Studienantritt psychische Probleme gehabt.
Worauf ich hinaus will, ist der Befund, dass von den Studierenden mit den Problemen nur rund 16% professionelle Hilfe erhalten hatten. Nun muss man wissen, dass schon heute, also bei diesen 16%, die Wartezimmer für die psychologischen Sprechstunden überquellen – und das, obwohl viele Hochschulen hier in den letzten Jahren immer mehr Stellen geschaffen haben. Auch für psychologisch-psychiatrische Sprechstunden außerhalb der Bildungseinrichtungen gilt Ähnliches.
“Realprävalenz” nicht aussagekräftig
Genauso wenig wie die Hochschulen 20% der Studierenden psychologisch-psychiatrisch betreuen können, kann die Gesellschaft 40% der Gesamtbevölkerung behandeln. Zum Glück muss sie es aber auch nicht. Auch wenn leider nicht alle Hilfe bekommen, die sie brauchen, brauchen sie bei weitem nicht alle, die bei einem epidemiologischen Fragebogen ein positives Ergebnis bekommen.
Diese Studien messen also gerade nicht die “Realprävalenz” psychischer Störungen im klinisch relevanten Sinne. Zum Glück, denn sonst wäre unsere Gesellschaft schon längst zusammengebrochen! Es handelt sich schlicht um wissenschaftlich-standardisierte und quantifizierte Annäherungen an den klinischen Alltag, die vor allem einer Gruppe dienen: den Epidemiologen selbst und nicht den Ärzten, Psychotherapeuten oder Patienten. Für ein echtes Hilfsbedürfnis sind sie kein guter Indikator.
Fehlende empirische Grundlage
Dornes scheint sich dessen bewusst zu sein, wo er in seinem Buch andeutet, nicht alle der durch die Epidemiologen identifizierten Personen seien behandlungsbedürftig. Das stimmt zwar – warum redet er dann aber von der “Realprävalenz” psychischer Störungen? Und warum zieht er dann nicht den logisch zwingenden Schluss, dass die epidemiologischen Studien keine Aussagekraft für seine Verteidigung des Kapitalismus haben, wenn sie nicht das Hilfsbedürfnis der Menschen erheben?
Wenn der Autor sich nicht auf die epidemiologischen Studien stützten kann und wenn er den echten Diagnosezahlen misstraut, dann bleibt ihm schlicht keine empirische Basis für seinen Standpunkt. Das ist eine überraschend schwache Position für jemanden, der seine Diskussionsgegner, nämlich die sozialwissenschaftlichen Gesellschaftskritiker, für ihre angebliche Unkenntnis der Empirie geißelt.
Vorläufige Zusammenfassung
In diesem ersten Teil haben wir die Grundlagen diagnostischer Gespräche der Psychologen und Psychiater besprochen und mit der Arbeit von Epidemiologen verglichen. Dabei ergab sich, dass die Gültigkeit der individuellen Diagnose über derjenigen der Fragebogenstudien steht. Auch konnten häufige Relativierungen, mit denen der starke Anstieg psychiatrisch-psychologischer Diagnosen wegerklärt werden soll, widerlegt werden: Psychische Störungen sind weder ein Schnupfen noch eine andere Form von Rückenschmerzen.
Insbesondere verfangen Martin Dornes’ Interpretationen der epidemiologischen Forschung nicht. Damit steht wieder die Frage im Raum, ob die wirtschaftlich-sozialen Verhältnisse nicht doch die psychische Gesundheit der Menschen beeinflussen. Darum wird es im zweiten Teil weiter gehen, in dem wir uns anschauen, wie die Patienten “mit den Füßen abstimmen”. Dabei wird sich ergeben, dass die Deutschen noch nie so krank waren wie heute – jedenfalls im 21. Jahrhundert.
Hinweis: Dieser Beitrag erscheint parallel auf Telepolis – Magazin für Netzkultur.