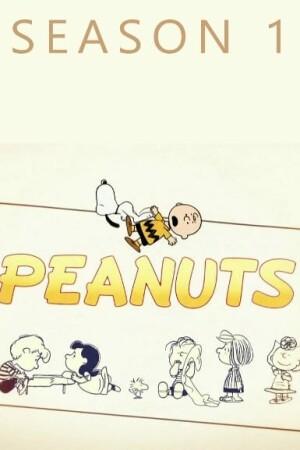Immer mehr Leute wollen einen Hund. Aber die Hoffnung auf bedingungslose Liebe endet oft im Drama
Während der Pandemie schaffen sich mehr Menschen denn je einen Hund an. Das einheimische Angebot kann die Nachfrage längst nicht mehr decken. Davon profitieren kriminelle Welpenhändler im Ausland und dubiose Tierschutzorganisationen.
Barbara Klingbacher, Text und Michael Sieber, Bilder
02.07.2021, 05.55 Uhr
Teilen
Die französische Bulldogge Monty wurde nachts um zwei an der Grenze übergeben.
1. Monty aus dem Welpenhandel
Als Monty in der Schweiz ankommt, ist sein kurzes Leben fast wieder vorbei. Dabei schien es ihm so gut zu gehen, auf all den Fotos und Videos, wo die französische Bulldogge auf dem Wohnzimmerteppich spielte oder in blütenweissen Tüchern schlummerte. Der Welpe wachse umsorgt in einer Familie auf, hatte man seinen neuen Besitzern geschrieben, ausserdem stamme er von besonders gesunden, nicht überzüchteten Eltern ab. Enrico Noris und seine Freundin Eylem Özlem konnten Montys Ankunft kaum erwarten. Mit 10 Wochen würde er alt genug sein für die Fahrt von Portugal an die Schweizer Grenze. In einem speziell ausgerüsteten Transporter sollte er anreisen, mit anderen Welpen und einer Pflegerin, die für Wasser und Futter und Pausen sorgte. So stellte es sich das Paar aus Uster jedenfalls vor. Dann endlich würde das neue Leben beginnen, nach dem sich die beiden sehnten: das Leben als Hundebesitzer.
Während der Pandemie erwachte diese Sehnsucht in mehr Menschen als je zuvor. Schliesslich ist jeder Hund ein Versprechen: auf Spaziergänge und bedingungslose Liebe, auf Kuschelstunden auf dem Sofa und das Gefühl, nie mehr allein zu sein. 530000 Hunde leben derzeit in der Schweiz, besonders häufig hören sie auf die Namen «Luna», «Kira» und «Nala» oder «Rocky», «Lucky» und «Max». Die nationale Hundedatenbank Amicus zeigt, dass ihre Zahl seit längerem ansteigt. Doch während in normalen Jahren jeweils rund 5000 Hunde dazukamen, waren es zwischen April 2020 und April 2021 dreimal so viele. Rechnet man die Tiere ein, die gestorben und ersetzt worden sind, haben sich die Schweizer seit Beginn der Pandemie gegen 70000 neue Hunde angeschafft.
Das einheimische Angebot deckt diese Nachfrage längst nicht mehr. Erst recht nicht, wenn sich jemand einen Modehund wünscht, einen Zwergspitz etwa, einen Chihuahua oder eben: eine französische Bulldogge, wie Monty eine ist. Seriöse Züchter in der Schweiz führen meist Wartelisten, verweisen auf den nächsten Wurf, aufs nächste oder übernächste Jahr. Aber das Internet hat den Menschen die Geduld wegtrainiert. Warum soll man so lange auf den Welpen eines hiesigen Züchters warten, wenn online Hunderte sofort verfügbar sind? Ausserdem haben sich die Konsumenten an unendliche Auswahl gewöhnt, und Züchter entscheiden gerne selbst, welcher Welpe zu welcher Person passt – wenn sie der Person überhaupt einen anvertrauen. Im Netz hingegen kann man den drolligsten oder den mit der hübschesten Farbe bestellen, als wäre er ein Pullover bei Zalando. Deutlich mehr als die Hälfte aller Hunde in der Schweiz stammen heute aus dem Ausland.
Anders als viele Leute mit einer diffusen Sehnsucht hatten sich Enrico Noris und Eylem Özlem über den Hund ihrer Träume genau informiert. Der Modeimporteur und die Kosmetikerin wünschten sich seit drei Jahren eine französische Bulldogge, weil Noris’ Bruder bereits eine hat. Aber die beiden wussten, dass das Aussehen bei manchen Rassen über der Gesundheit steht – den Tieren werden Merkmale angezüchtet, unter denen sie ein Leben lang leiden. Dackel etwa haben kürzere Beine und einen längeren Rücken als früher, was zu Bandscheibenvorfällen und der «Dackellähmung» führen kann. Bei Labradoren ist die Nachfrage nach trendigen Fellfarben wie «Silber», «Champagner» oder «Charcoal» gestiegen, die dank einem bestimmten Gen auftreten. Dieses löst aber oft so starken Juckreiz aus, dass die Tiere sich wundkratzen und lebenslang Medikamente brauchen. «Teacup Dogs» – Miniversionen von Chihuahuas, Pudeln, Zwergspitzen – wurden durch Bilder von Hunden in Teetassen in den sozialen Medien begehrt. Doch weil man zwar die Körper winzig züchten kann, nicht aber das Gehirn, werden Welpen mit Wasserköpfen geboren; sie haben starke Schmerzen und sterben früh.
Auch die französische Bulldogge ist gewollt missgebildet. Damit der Kopf dem Kindchenschema entspricht, das mit grossen Augen und flachem Gesicht einen Jöh-Effekt auslöst, hat man ihr eine verkürzte Nase angezüchtet. Die typischen Merkmale der «Frenchies» – das scheinbar fröhlich hechelnde Lächeln, das drollige Schnaufen und Schnarcheln – finden die Besitzer so lange süss, bis ihr Hund wegen Sauerstoffmangels umkippt. Die grosse Mehrheit der Bulldoggen hat Atemprobleme, bei jeder vierten sind sie so stark, dass der Hund nur im Sitzen schlafen kann. Ausserdem kommen zwei von drei «Frenchies» per Kaiserschnitt auf die Welt. Der Geburtskanal der Hündin ist zu schmal für die grossen Köpfe ihrer Welpen.
Um die Atemnot zu vermeiden, wollten Enrico Noris und Eylem Özlem eine Bulldogge aus einer Retrozucht, bei der die Hunde aussehen wie früher mal. Allerdings wachsen mit den Nasen die Wartelisten, weil es wenige Retrozuchten gibt. Als das Paar dann Monty zum ersten Mal sieht, vernebeln die Gefühle den Verstand. Sein Foto leuchtet auf Facebook auf – ein wenige Tage alter Welpe, weiss mit schwarzen Flecken und einem Näschen, das etwas länger wirkt. Alles scheint seriös. In den Kommentaren bedanken sich mehrere Schweizer für die perfekte Organisation und für die Freude, die der Welpe in ihr Leben bringe.
Die Betreiberin der Seite bestätigt, dass Monty aus einer Retrozucht stamme. In den kommenden Wochen würden die Welpen sozialisiert, entwurmt, geimpft, mit einem Chip unter der Haut und allen Papieren ausgestattet; zwei Mal im Monat führe man einen Hundetransport an die Schweizer Grenze durch.
Noris und Özlem schicken eine lange Mail und beschreiben, wie Monty bei ihnen leben wird. Die Portugiesin antwortet, sie müssten sich mit der Anzahlung beeilen; wie immer im Netz schauen sich auch viele andere gerade das Produkt an. 2500 Euro soll der Rüde kosten, 500 sofort, die restlichen 2000 bei der Übergabe an der Grenze in St-Louis bei Basel. Es ist der hohe Preis, der Noris und Özlem endgültig überzeugt. Schliesslich hatten sie von osteuropäischen Massenzuchten gelesen, die «Billigwelpen» verschachern. Ihr Frenchie aber stammt aus Portugal und kostet etwa gleich viel wie einer aus der Schweiz.
Am Freitagabend vor Montys Ankunft klingelt das Telefon. Der Transporter sei zu früh dran, sie müssten Monty nun nachts um zwei abholen. Zum ersten Mal kommt dem Paar der Verdacht, das Ganze sei vielleicht doch nicht so seriös. Nun fällt ihnen auch auf, dass auf der Facebook-Seite fast täglich neue Welpen aus liebevollen Familienzuchten angeboten werden. Nicht nur Bulldoggen, auch Chihuahuas, Zwergspitze oder Yorkshire-Terrier scheinen im Wochentakt geboren zu werden. Aber natürlich ist es bereits zu spät. Noris bedingt sich zwar aus, nur 1000 Euro zur Übergabe mitzubringen und den Rest zu überweisen. Aber es ist undenkbar, den Hund, dessen Aufwachsen sie seit Wochen verfolgen, nicht abzuholen.
Der Kontakt über Facebook, die Behauptung, es handle sich um eine besondere Zucht, der hohe Preis, die Übergabe mitten in der Nacht: «Das ist alles typisch», sagt Lucia Oeschger vom Schweizer Tierschutz. Die Biologin verfolgt den internationalen Welpenhandel seit Jahren. Er habe sich in letzter Zeit stark in die sozialen Medien verlagert. Und obwohl die meisten Händler aus Osteuropa agierten, hätten auch «Vermehrer» in Ländern wie Portugal oder Spanien das Millionengeschäft mit den jungen Hunden entdeckt.
Die Probleme bleiben die gleichen. Die Welpen stammen aus eigentlichen Fabriken, in denen die Muttertiere in Hinterhofverschlägen oder Zwingeranlagen eingepfercht sind. Sie gebären Wurf um Wurf, bis man sie entsorgt. Die Welpen werden zu früh von den Müttern getrennt, sie sind oft fehlernährt und krank. Dazu wachsen sie in einer Umgebung auf, in der es an den Eindrücken fehlt, die in diesem Alter so wichtig wären. Welpen können nur in einem gewissen Zeitfenster geprägt und sozialisiert werden. Passiert das nicht, leiden sie später oft unter dem «Deprivationssyndrom»: Solche Hunde stehen unter Dauerstress, weil sie nicht gelernt haben, mit Neuem klarzukommen. Sie fürchten sich vor Menschen, Tieren, Geräuschen, also vor so gut wie allem, was sie in der Schweiz erwartet. Und manchmal macht sie die Furcht aggressiv.
Die Hundehändler seien schlau, sagt Oeschger, «und lernfähig». Weil heute viele Leute wüssten, dass der allzu billige Welpe ein Hinweis auf eine unseriöse Massenzucht sei, haben ausländische Verkäufer die Preise erhöht. Sie locken nun gern mit dem Versprechen einer speziellen Zucht an: mit seltenen Fellfarben etwa oder längeren Nasen. Und wenn sie jetzt sage, man erkenne seriöse Züchter daran, dass sie sich dafür interessierten, zu wem ihre Hunde kämen – «dann wird es nicht lange dauern, bis Vermehrer den Interessenten pro forma solche Fragen stellen».
Enrico Noris und Eylem Özlem mit Monty.
Die Hundemafia kennt aber auch Tricks, um an Käufer zu gelangen, die gar keinen Welpen aus dem Ausland wollen. Man gibt vor, die Tiere seien in der Schweiz geboren. Auf Plattformen wie Anibis oder Tutti sind unzählige Inserate von «Hobbyzuchten» geschaltet, die eine Schweizer Adresse angeben. Allerdings findet der «Züchter» einen Vorwand, warum die Welpen nicht dort abgeholt werden können. Stattdessen bringt er die ausländischen Welpen direkt zu den Besitzern oder übergibt sie auf einem Parkplatz. Überprüft man solche Adressen, ist erstaunlich, wie oft in städtischen Mehrfamilienhäusern angeblich Hunde gezüchtet werden. «Und Sie würden sich wundern, wie viele Züchter an irgendeiner Bahnhofstrasse wohnen, manchmal gar an der Zürcher Bahnhofstrasse», sagt Oeschger.
Doch selbst wer seinen Welpen besucht, hat keine Garantie. Manche Hundehändler haben Helfer in der Schweiz, die ihre Wohnung als Showroom zur Verfügung stellen – oder sie mieten kurzzeitig eine einzig zu diesem Zweck an. Dann setzt man einen Hund der gleichen Rasse zwischen die illegal eingeführten Welpen und gibt vor, es sei das Muttertier. Oeschger, die sich auch mal als Interessentin ausgibt, hat schon erlebt, dass dieser Hund nicht nur kein Muttertier, sondern ein Rüde war.
Mitten in der Nacht fährt Eylem Özlem über die Schweizer Grenze bei St-Louis. Als Treffpunkt ist die erste Tankstelle auf der französischen Seite ausgemacht. Ein Mann steigt aus einem Lieferwagen. Er ist die 2000 Kilometer alleine durchgefahren. Der Laderaum ist vollgepackt mit Fernsehern, Radios und einer Polstergruppe, ganz vorn steht eine Transportbox, in der Monty auf Zeitungsschnipseln hockt. Der Winzling zittert, hat kein Wasser, alles ist mit flüssigem Kot verschmiert. Özlem drückt dem Fahrer 1000 Euro in die Hand, «no good, no good!» sagt der verärgert. Das Zollamt, wo sie den Hund anmelden müsste, ist um diese Zeit nicht besetzt; Özlem fährt nach Uster durch.
Der Grund, warum die Übergabe ennet der Grenze stattfindet, liegt an den hiesigen Gesetzen: Wer in der Schweiz mit Hunden handelt, braucht eine Bewilligung und muss Vorschriften zum Tierschutz einhalten. Führen die Käufer ihren Hund selbst ein, umgeht der ausländische Händler das Risiko des illegalen Imports. Solange die Welpen älter als acht Wochen sind und mit dem Chip und den Papieren alles stimmt, ist ihr Geschäft nicht einmal in jedem Fall illegal. Allerdings zeigt sich am Zoll oft, dass Impfungen fehlen oder der Chip keinen Ländercode hat – anonyme Chips gibt’s problemlos im Internet zu kaufen.
24 Stunden nach der Ankunft kippt Monty in seinem neuen Zuhause um. «Einschläfern wäre billiger», sagt die Notfalltierärztin prüfend zu Noris, bevor sie dem Welpen eine Infusion legt und ihn ins Zürcher Tierspital überweist. Dort wird er von Mitarbeitern in Schutzanzügen abgeholt und auf die Isolierstation gebracht. Noris muss eine Anzahlung leisten und unterschreiben, dass er für alle Kosten aufkommen werde.
Das Tierspital wird seit Monaten überrannt von Leuten mit kranken Welpen aus dem Ausland. Längst nicht alle Besitzer sind bereit, für die Behandlung zu bezahlen. Vor allem jene nicht, die einen ausländischen Hund gekauft haben, weil er günstiger war. Die Tierärzte im Tierspital tun alles, um es zu vermeiden, aber: Manchmal muss ein solcher Welpe eingeschläfert werden.
Noris zögert keine Sekunde: Er will, das Monty die beste Behandlung erhält. Aber die Prognose ist unsicher, und besuchen können die neuen Hundebesitzer ihr Tier nicht. Sie können nur anrufen und fragen, ob es noch lebe. Wenn das Telefon klingelt, schrecken sie auf aus Furcht, es sei das Tierspital.
Aber Monty überlebt. Er litt an Paro-Viren, einer hochansteckenden Hundeseuche, die unter Auslandwelpen weit verbreitet ist. Zusätzlich hat er Darmparasiten, und sein Geburtsdatum ist falsch. Die Tierärztin schätzt, er sei bei seiner Ankunft nicht 10, sondern 6 oder 7 Wochen alt gewesen; in diesem Alter dürften Welpen nur mit der Mutter transportiert werden.
Während Monty im Spital war, hat sich die Betreiberin der Facebook-Seite mehrmals gemeldet, um die 1000 Euro einzutreiben. Noris hat ihr mit einer Strafanzeige gedroht; seither hat er nichts mehr aus Portugal gehört. Die Tierarztrechnungen sind inzwischen auf mehrere Tausend Franken angestiegen, dazu kommt eine Busse von 400 Franken, weil das Paar Monty nicht sofort verzollt hat. Aber Enrico Noris und Eylem Özlem ist das egal. Sie lieben ihren Frenchie, dem es von Tag zu Tag bessergeht. Bald werden sie kleine Spaziergänge unternehmen und die Welpenschule besuchen, ganz so, wie sie sich das Leben als Hundehalter vorgestellt hatten. Aber wenn Monty gestorben wäre, sagt Noris, wäre es das Ende ihres Traums gewesen. «Ich hätte mir nie mehr einen Hund angeschafft.»
2. Tank, der letzte Hund im Tierheim
Der einzige Hund, der im Tierheim des Zürcher Tierschutzes noch zu haben war: Rottweiler Tank.
Manchmal überdauern die Spuren der Enttäuschung im Internet. In den Google-Bewertungen einzelner Tierheime etwa. «Das Personal spielt sich als Gottheit auf, wo der Interessent auf die Knie fallen muss, um zu danken, dass er ein Tier adoptieren darf!» steht da. Oder: «Immer haben sie eine Ausrede, warum dieser Platz nicht gut genug ist.» Oder: «Es ist einfacher, ein Kind zu adoptieren als einen Hund!»
Im Mai 2021 ist das Tierheim des Zürcher Tierschutzes so gut wie leergeräumt. Der einzige Hund, der zu haben wäre, ist Tank, ein reinrassiger Rottweiler. Ein verschmuster Rüde, steht in seinem Steckbrief, verspielt und von einem freundlichen Wesen. Allerdings, sagt seine Betreuerin Nikita van Dorst, habe er «ein paar kleine Baustellen, zum Beispiel Bewegungsreize». Das heisst: Wenn sich etwas bewegt, wollen 40 Kilo Verspieltheit hinterher, egal ob dieses Etwas eine Katze oder ein Velofahrer ist.
Tank ist eineinhalb Jahre alt, einen Drittel seines Lebens hat er im Tierheim hinter dem Zürcher Zoo verbracht. Im Januar 2021 rief ein junger Mann an und fragte, ob er seinen Hund abgeben könne, am besten noch am gleichen Nachmittag. Als er vorbeikam, sagte er, er habe den Rottweiler als Welpen im Frühling 2020 in Deutschland gekauft, sei zwei-, dreimal mit ihm in einer Hundeschule gewesen, nun ziehe er aus beruflichen Gründen ins Ausland. 20 Minuten später war der Hundehalter kein Hundehalter mehr.
So emotionslose Abschiede erlebe sie selten, sagt Nikita van Dorst, «ihm war sein Tier wirklich egal». Aber die Tierpflegerin zweifelt nie die Begründungen an, die ihr die Leute liefern: die überraschenden Job- oder Wohnungswechsel, die Trennungen, nach denen keiner das Tier allein versorgen könne, die Allergien, die leider ganz plötzlich aufgetreten seien – das nimmt sie nickend zur Kenntnis. Man will niemanden abschrecken, sein Tier hier abzugeben. Wenn einer seinen Hund los werden will, dann wird er ihn sowieso los. Da ist es besser, er bringt ihn hierher.
Die Nachfrage nach Hunden ist während der Pandemie gestiegen, gleichzeitig gaben weniger Leute ihr Tier im Heim ab. Rommy Los, der Leiter des Tierheims, vermutet, das liege am Homeoffice. Falls jemand seinen Hund nicht betreuen kann, springen Nachbarn oder Verwandte kurzfristig ein. «Die Frage ist, was passiert, wenn die Leute, die sich jetzt einen Hund angeschafft haben, zurück ins Büro müssen oder in die Ferien wollen.» Man müsse sich der Verantwortung bewusst sein, die ein Hund mit sich bringe, und bereit, einen Teil des eigenen Lebens anzupassen, damit das Tier ein schönes Leben habe. «Und das je nach Rasse für die nächsten 15 Jahre.»
Tank hat in den vergangenen Monaten viel gelernt. Gleich nach seiner Ankunft erarbeitete Nikita van Dorst einen Trainingsplan, nach dem der Hund jeden Tag bewegt, beschäftigt und ausgebildet wird. Bald stellte sie auch seinen Steckbrief ins Internet und teilte diesen hin und wieder auf Facebook. In manchen Wochen meldeten sich mehrere Leute. Und nachdem Tank in der Sendung «Tierisch» eines Lokalfernsehens vorgestellt worden war, brauchte van Dorst einige Stunden, um die Anfragen abzuarbeiten. Schliesslich ist Tank jung und reinrassig – bei einem Schweizer Züchter würde so ein Rottweiler mindestens 2000 Franken kosten. Das Zürcher Tierheim gibt ihn für die Pauschalgebühr ab, die hier für alle Hunde gilt: 540 Franken. Trotzdem ist Tank noch immer da. Das liegt daran, wie das seriöse Tierheim arbeitet.
In der Vorstellung vieler Menschen ist ein Tierheim eine Art Selbstbedienungsladen. Sie sehen sich durch die Gänge laufen, aus Dutzenden Hunden ihren Favoriten auswählen, den sie dann gleich mit nach Hause nehmen. Stattdessen steht ihnen ein mehrstufiger Prozess bevor, der mit vielen Fragen beginnt, bevor sie ein Fitzelchen Fell zu sehen bekommen: Beruf? Arbeitszeiten? Alter der Kinder? Man muss angeben, ob man in einem Haus oder einer Wohnung lebe und auf wie vielen Quadratmetern. Wohnt jemand zur Miete, ist die schriftliche Einwilligung des Vermieters einzureichen, dass Haustiere erlaubt seien. Manchmal will ein Tierheim auch wissen, wer das Tier im Krankheitsfall betreut, welchen Hundesport man plant und was wäre, wenn ein schon älteres Tier wieder in die Wohnung machte.
Nach der Befragung gibt es ein Gespräch, bei dem man den Hund kennenlernt. Danach folgen mehrere Besuche mit Spaziergängen, dann ein Probetag oder ein Probewochenende bei den Interessenten zu Hause, dann ein mehrwöchiges «Probewohnen». Erst dann wechselt der Hund den Besitzer Nach einigen Monaten macht das Tierheim einen Kontrollbesuch.
Tank wird wegen seiner stürmischen Art nicht zu kleinen Kindern, Katzen oder Kleinhunden gegeben, steht in seinem Steckbrief. Ausserdem wünscht sich van Dorst von den Haltern Erfahrung mit Molossern, also mit massigen, doggenartigen Hunden, am liebsten mit Rottweilern. Anfangs habe sie nur «hundeerfahren» geschrieben, sagt sie, «aber wenn jemand mit einem Labrador aufgewachsen ist, reicht das für einen Rottweiler einfach nicht». Manche Interessenten sortiert sie per Mail oder am Telefon aus, andere springen selber wieder ab, wenn sie mehr über den Hund erfahren.

Jetzt entscheidet sich, ob Tank ein guter oder ein gefährlicher Rottweiler wird.
Die übrigen lädt sie ein, sich Tank anzuschauen. Van Dorst will die Leute kennenlernen. Genauso wichtig ist ihr, dass der Hund die Leute kennenlernt. Deshalb beobachtet die Tierpflegerin genau, wie das erste Treffen verläuft – bei einem Hund wie Tank geht sie auch immer mit auf die Spaziergänge. Sie registriert, wie jemand reagiert, wenn der Rottweiler in eine andere Richtung will oder wenn ein «Bewegungsreiz» auf dem Velo auftaucht. Ausserdem achtet sie darauf, wie lernwillig die Leute sind: Können sie Kritik hinnehmen und Tipps umsetzen? Oder glauben sie, schon alles zu wissen? Tank sei ein Teenager und stehe an einer Kreuzung, sagt sie, «Jetzt entscheidet sich, ob aus ihm ein lieber oder ein gefährlicher Rottweiler wird.»
Im Moment gibt es vielversprechende Interessenten für Tank. Auf der einen Seite ist da eine Hundetrainerin, die schon vier Hunde hat, darunter einen Rottweiler. Sie war bereits zwei Mal zu Besuch und «hatte es wirklich gut im Griff», sagt van Dorst. Auf der anderen Seite ist dieses Paar, das schon fünf Mal da war. Die beiden erfüllen die Anforderungen eigentlich nicht ganz. Sie haben weniger Erfahrung mit Hunden als erhofft und keine mit Molossern. «Aber es sind tolle Leute, die Zeit haben, lernen wollen und die sich sogar schon Hundetrainer angeschaut haben, um mit Tank zu arbeiten.» Van Dorst registriert auch, wie Tank auf den Besuch reagiert, wertet dabei aber nur die ersten zwei Treffen. Danach entstehe eine Bindung, die das Bild verfälsche. Bei der Hundetrainerin war Tank anständiger und gehorsamer, sagt sie, bei dem Paar offener und freudiger.
Noch ist unklar, wer den Hund zu sich nehmen wird. Die Hundetrainerin überlegt, ob ein fünfter Hund ins Leben passt. Das Paar muss mit dem Vermieter klären, ob die grundsätzliche Erlaubnis, einen Hund zu halten, auch für einen Rottweiler gelte. Was passiert, wenn beide Parteien Tank wollen? Dann liege die Entscheidung bei ihr, sagt van Dorst. Und wenn beide absagen? «Dann warte ich, bis der Richtige kommt. Und er wird kommen.» Schliesslich geht es nicht darum, ein Tier so schnell wie möglich zu vermitteln. Sondern zum letzten Mal.
Es ist ganz einfach zu erklären, warum der Besuch im Tierheim für manche mit einer Enttäuschung enden muss. Man sucht hier keine Hunde für Menschen. Man sucht Menschen für Hunde.
3. Pei-Pei, «gerettet» vom Auslandtierschutz
Der Shar-Pei-Mischling Pei-Pei liess sich von niemandem anfassen, als er in die Schweiz kam.
Pei-Peis Reise ins Glück beginnt mit einem Foto auf der Facebook-Seite einer rumänischen Tierschutzorganisation. Einige Wochen später wird sie auf einem Schweizer Sportplatz enden, wo mit dem Betäubungsgewehr auf ihn geschossen wird. Dazwischen gab es kurz Hoffnung auf ein Happy End.
«Happy End» ist ein Begriff, der im Auslandtierschutz gern verwendet wird. All die Hunde, die in Ländern wie Rumänien, Ungarn, Spanien auf der Strasse oder in Tierheimen leben, sollen ihr «forever home» finden. Die Geschichten auf den Homepages sind traurig: ausgesetzte Hunde, Strassenhunde, Hunde in Tötungsstationen und Welpen, «grausam im Müll entsorgt». «Warum bin ich immer noch alleine?» steht unter dem Foto eines Mischlings mit traurigen Augen und unter einem anderen: «Johnny will nicht im Tierheim sterben.» Mitleid ist ein mächtiges Gefühl – und manchmal eine Geschäftsgrundlage.
Auch der neue Besitzer von Pei-Pei, der damals noch anders heisst, lässt sich von den Hundeaugen erweichen. Zwei Jahre lang tauchte das Foto des Rüden auf Facebook auf. Darunter stand: «Mein Schicksal liegt in Ihren Händen!» Handliche Junghunde finden rascher einen Platz, noch beliebter sind Welpen. Pei-Pei aber ist bereits fünf oder sechs Jahre alt, und dazu gross und schwarz. Das schreckt viele Leute ab.
Nicht aber den Mann, der Pei-Pei retten will. Als er sich bei der Tierschutzorganisation meldet, ist er achtzig und besitzt bereits drei Hunde. Ein Tierheim oder ein seriöser Züchter in der Schweiz würde ihm wohl keinen vierten anvertrauen. Weil seine Frau keinen weiteren Hund will, zieht der Mann die Anfrage für Pei-Pei bald wieder zurück. Doch nun zielen die Tierschützer direkt auf sein gutes Herz: Es sei fies dem Hund gegenüber, einen Rückzieher zu machen, sagt man ihm, als ob der sich schon auf sein Schweizer Zuhause gefreut hätte. Er sei seine letzte Chance gewesen. Schliesslich gibt der alte Mann nach.
Pei-Pei steigt in Rumänien in den «Happybus» in Richtung Deutschland, wo ihn sein neuer Besitzer abholt und in die Schweiz einführt. Als er zu Hause den Kofferraum öffnet, rennt der Hund weg und flüchtet auf einen umzäunten Fussballplatz. Wenn der Mann ihn in eine Ecke drängen will, schnappt Pei-Pei nach ihm. Schliesslich wählt man die Notrufnummer der Stiftung Tierrettungsdienst. Karin H., eine freiwillige Mitarbeiterin, die nicht mit vollem Namen genannt sein möchte, schafft es zwar, sich dem Rüden über die nächsten Stunden immer mehr zu nähern. Doch gegen Abend bietet sie trotzdem den Grosstierrettungsdienst auf, der ein Betäubungsgewehr hat. Pei-Pei wird narkotisiert.
Es ist klar, dass man den Hund nicht bei seinem Besitzer lassen kann. Er ist völlig verängstigt und lässt sich von niemandem anfassen; bei der nächsten Gelegenheit würde er wieder wegrennen. Pei-Pei wird ins Tierheim Pfötli in Winkel ZH gebracht, wo man auf anspruchsvolle Hunde spezialisiert ist und grosse Zwinger hat. Sie sind so gebaut, dass der Hund eine Weile ohne Kontakt zu Menschen leben kann. Karin H. sagt: «Als ich Pei-Pei bewusstlos dort liegen sah, dachte ich kurz, es wäre besser, wenn dieser Hund nicht mehr erwacht.»
Die 44jährige sitzt in ihrem umzäunten Garten im Zürcher Oberland. Den ersten Interviewtermin hatte sie kurzfristig abgesagt, ein Notfall: Sie versuchte, einen Hund einzufangen – den gleichen zum zweiten Mal. Auch er stammt aus dem Auslandtierschutz. Beim ersten Mal hatte H. ihn erwischt und der Besitzerin zurückgegeben, mit einem schlechten Gefühl, sagt sie. Zwei Wochen später war er wieder weg. Panisch sei er auf der Autobahn gerannt und dann im Wald verschwunden. «Was mit diesen Hunden passiert, ist Tierquälerei unter dem Deckmantel von Tierschutz», sagt H., die bei Hunderten Tierrettungseinsätzen dabei war. Die neuen Besitzer glaubten, sie würden einem Hund ein tolles Leben schenken. «Aber nicht jeder Hund will dieses Leben. Weil er es nicht kennt.»
Der «Tierschutzimport» hat in den vergangenen Jahren stark zugenommen. Wer sich auf diese Art einen Hund besorgt, kombiniert gleich zwei Kaufanreize: Das gute Gefühl, einem Hund ein besseres Leben zu schenken, so wie im Tierheim. Und die Auswahl und sofortige Verfügbarkeit, so wie beim Welpenhandel. Einen Hund aufzunehmen, den eine Organisation aus dem Ausland vermittelt, kann wunderbar funktionieren. Aber es muss nicht. «Die meisten Menschen glauben, wenn sie nur genug Liebe und Geduld für ihren Hund aufbrächten, komme alles gut», sagt Christine Keller, Tierschutz- und Ethikbeauftragte bei der Stiftung Tierrettungsdienst. Aber das gilt eben nicht für jeden Hund. Was es bei schwierigen Hunden brauche, sei Fachwissen und Training, Training, Training. «Aber selbst dann klappt es nicht immer.»
Das Problem beginnt mit der schieren Menge. Manche Organisationen plazieren 2000 Hunde im Jahr. Dabei wäre es besser, sie würden nur 200 vermitteln, diese dafür seriös. Oft fehlt es den Mitarbeitern vor Ort an der Zeit und am Fachwissen, die Tiere richtig einzuschätzen. So kommen Hunde in die Schweiz, die dem Leben hier nicht gewachsen sind, und zwar zu Besitzern, die sich oft überschätzen.
Nicht jeder Hund sehnt sich nach einem Leben auf dem Sofa. Manche Streuner sind draussen glücklicher als in einer Wohnung in der Schweiz. Deshalb helfen seriöse Organisationen immer auch vor Ort, zum Beispiel mit «Catch-Neuter-Vaccinate-Release»-Programmen: Die Strassenhunde werden kastriert, geimpft und in ihrem Territorium wieder freigelassen. Studien zeigen, dass solche Programme die Zahl der Streuner am effektivsten verringern. Denn die Zahl hängt davon ab, wie viel Nahrung, Wasser und sichere Unterschlüpfe Hunde in einem Gebiet finden.
Streunerpopulationen bleiben immer gleich gross. Entfernt man Hunde aus dem Gebiet – egal, ob man sie tötet oder ins Ausland verschickt –, vermehren sich die verbliebenen stärker, oder es wandern neue ein. Werden aber die kastrierten Tiere zurückgebracht, wirken sie wie Platzhalter, die sich nicht fortpflanzen und gleichzeitig unkastrierte Hunde fernhalten.
Man müsse die Probleme vor Ort mit dem Verstand lösen, nicht nur mit dem Gefühl, sagt Christine Keller. Aber die Bandbreite der Tierschutzorganisationen im Ausland ist gross. Es gibt seriöse, die sich auskennen, und es gibt sehr viele, die es gut meinen, aber unterschiedlich gut machen. Die Schlechten darunter wollen einfach so viele Hunde wie möglich retten. Man preist sie mit herzzerreissenden Geschichten an, schreibt aber kaum Relevantes zum Charakter und Verhalten – oder das, was dasteht, stimmt nicht. Solche Organisationen stehlen sich aus der Verantwortung, indem sie von den Interessenten «Hundeerfahrung» verlangen. «Wenn dann etwas schiefgeht, ist immer der Halter schuld.»
Auf den Homepages wimmelt es von «Happy Ends», nie aber ist etwas von den Leuten zu lesen, die an ihrem Hund scheitern. Sie trauen sich meist nicht, negatives Feedback zu geben, weil sie ja glauben, sie hätten alles falsch gemacht. «Deshalb leben diese Tierschützer in einer Art Positivblase», sagt Keller.
Es gibt aber auch Menschen, die im Leid der Hunde ein Geschäft entdeckt haben. Schliesslich verlangen so gut wie alle Organisationen von den neuen Besitzern eine Gebühr von mehreren Hundert Euro, um damit ihren Betrieb zu finanzieren.
Die Hundemafia hingegen steckt dieses Geld lieber ein. So werden wahllos Hunde vermittelt, solange jemand für sie zahlt. Auch solche, die man dem Besitzer im Ausland zuvor gestohlen hat. Oder vom Tierschutz kastrierte Strassenhunde, aus Streunerpopulationen weggefangen. Und nicht jeder Welpe wird tatsächlich im Müll gefunden – man kann sie auch gezielt für den Tierschutzmarkt produzieren. Die gleichen Leute, die mit Rassewelpen handeln, haben entdeckt, dass ihnen «grausam entsorgte» Mischlingswelpen eine neue Käuferschicht erschliessen.
Was würde Christine Keller jemandem raten, der sich für einen Streuner aus dem Ausland interessiert? Man solle sich nie, wirklich nie einen Hund anschaffen, den man nicht kennengelernt habe, sagt sie. Entweder man sucht einen, der bereits auf einer Pflegestelle oder in einem Tierheim in der Schweiz lebt. Allerdings müssten auch dort Leute arbeiten, die Hunde fachkundig einschätzen und beschäftigen können.
Oder man reist nach Rumänien, Bulgarien oder Spanien und schaut sich das Tier und seine Lebensumstände vor Ort selber an. «Man wird mit diesem Hund zehn oder fünfzehn Jahre verbringen – das sollte es einem wert sein.»
Als Pei-Pei aus der Narkose aufwacht, ist er in einem Zwinger im Tierheim Pfötli. Sein Besitzer hat nach einem Gespräch auf den Hund verzichtet. Die ersten Tage verbringt Pei-Pei allein, dann startet das Training der winzigen Schritte. Jeden Tag setzt sich eine Tierpflegerin zu dem Hund in den Zwinger. Zuerst ist sie einfach da, dann liest sie ihm ein bisschen vor, dann wartet sie, bis er sie anschaut, sich ihr nähert, in ihrer Anwesenheit frisst und sich schliesslich von ihr anfassen lässt. Das kann Tage oder Wochen dauern, und eine Garantie auf Erfolg gibt es nicht. Zum Glück ist Pei-Pei zwar ängstlich, aber nie aggressiv. Es sei ein Tabuthema in der Szene, sagt Keller, und ein äusserst schwieriger Entscheid, bei dem man immer externe Fachleute zuziehe: «Aber es gibt Fälle, in denen man nicht verantworten kann, den Hund jemandem abzugeben.» Weil er zu gefährlich sei oder zu stark an seiner Angst leide. «Manchmal ist es die humanste Entscheidung, ein solches Tier einzuschläfern.»
Karin H. besucht den Hund, den sie auf dem Sportplatz eingefangen hat, immer mal wieder. Im Frühling frisst er ihr erstmals aus der Hand. Anfang Sommer lässt er sich von ihr berühren. Mitte Sommer kann sie mit ihm spazierengehen. Ab dem Herbst fährt sie jedes Wochenende zu ihm. Pei-Pei ist nun auf der Homepage der Stiftung zur Vermittlung ausgeschrieben, ein einziges Paar hat sich gemeldet. Als der Mann den Hund sieht, traut er sich nicht, ihm ein Leckerchen zu geben.
Karin H. hat bereits einen Hund und will keinen zweiten. Aber wenn sie Pei-Pei am Sonntagabend im Tierheim zurücklässt, weint sie. Eine befreundete Hundetrainerin bietet ihr an, gratis mit ihr zu trainieren, wenn sie Pei-Pei adoptieren wolle.
Allerdings müsste sie ihn zur Arbeit mitnehmen, und Hunde sind dort verboten. H. fragt ihren Chef trotzdem; es ist kurz vor Weihnachten. Er antwortet, er müsse sich das überlegen. Es klinge leider furchtbar kitschig, und sie glaube eigentlich nicht an Übersinnliches, sagt sie. «Aber damals schrieb ich dem Christkind einen Brief, in dem ich mir wünschte, dass Pei-Pei zu uns kommen kann.» Der Chef sagt Ja.
Ein Happy-End für Pei-Pei und seine neue Besitzerin Karin H.
An diesem Nachmittag im Frühsommer 2021 liegt Pei-Pei zufrieden im Garten, während Karin H. seine Geschichte erzählt, die auch ihre geworden ist. Dass sie gut endet, liegt am enormen Aufwand im Tierheim und den unzähligen Trainingsstunden, die H. mit ihrem Hund auf sich genommen hat. Nun erinnert nichts mehr daran, dass Pei-Pei sich einst von keinem Menschen anfassen liess. Die Tierschutzorganisation, die diesen unvermittelbaren Hund damals in die Schweiz vermittelte, wirbt übrigens noch heute mit seinem Foto – es steht unter der Rubrik «Happy End».
PS: Der Hund, den Karin H. beim abgesagten Interviewtermin vergeblich einzufangen versuchte, hatte leider überhaupt kein Glück: Er wurde ein paar Tage später von einem Zug überfahren.
Barbara Klingbacher ist NZZ-Folio-Redaktorin.
Michael Sieber ist Fotograf; er lebt in Zürich.
Dieser Artikel stammt aus dem NZZ-Folio zum Thema "Mensch und Tier" (erschienen am 5. Juli 2021). Sie können diese Ausgabe einzeln bestellen oder NZZ Folio abonnieren.
Illegal importierte Welpen werden wegen Tollwutgefahr eingeschläfert
Das St. Galler Veterinäramt hat drei illegal importierte Hundewelpen wegen Tollwut-Gefahr eingeschläfert. Der Händler soll zahlreiche weitere Welpen aus Serbien in die Schweiz geschmuggelt haben.
06.06.2019
Zu viele Hundewelpen aus Italien
Ein 62-jähriger IV-Rentner wollte einen Hunde-Import aufziehen, um sich von der IV lösen zu können. Vom Veterinäramt bekam er eine Bewilligung, er soll aber gegen mehrere Auflagen verstossen haben.
Tom Felber
19.02.2020