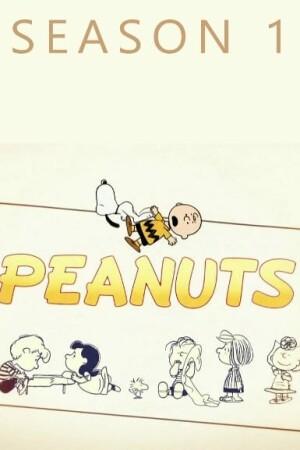Anzeige
K
arl-Adolf Kremer erzählt nicht einfach von der Ackerbohne, nein, er schwärmt davon. „Hochinteressant für unsere Ernährung“ sei die Pflanze – fettarm, glutenfrei, schnell satt machend. Das Brot, so der Landwirt aus dem Westen Nordrhein-Westfalens, werde dank der Ackerbohne frisch und feucht, der Hummus seiner Frau „phänomenal“. Die Bienen und Schmetterlinge freuten sich, der Boden auch.
Vor fünf Jahren hat sich Kremer dazu entschieden, die Pflanze anzubauen. Inzwischen wächst sie auf 15 Prozent seiner 100 Hektar, bald könnten es 20 Prozent werden. Er setzt damit auf eine Kultur, die lange als zu wenig ertragreich und nicht konkurrenzfähig galt. Mitte des vergangenen Jahrhunderts war die Ackerbohne weitgehend von den Feldern verschwunden. Doch das ändert sich gerade.
Lesen Sie auch
Artenvielfalt in Gefahr
Der Mensch als Meteorit
Bauern wie Kremer gibt es viele in Deutschland. Sie versuchen, mit alten Sorten und exotischen Arten der Krise auf ihrem Acker zu begegnen, ihre Scholle klimafest zu machen. Denn durch Trockenheit brechen Erträge ein, es wird zunehmend schwieriger, geeignete Pestizide zu finden. Unterstützt werden sie dabei sowohl von Umweltschützern als auch von Verbrauchern. Im kleinen Maßstab wird so bereits die Zukunft angebaut.
Anzeige
Angefangen hatte es bei Karl-Adolf Kremer mit der Europäischen Union. Seit zehn Jahren wird der Anbau von Eiweißpflanzen gefördert. Als Kremer begann, sich mit der Pflanze zu beschäftigen, stellte er zunächst fest: Abnehmer gibt es dafür eigentlich nicht. Der potenziell größte Markt, die Futtermittelherstellung, setzt größtenteils auf Soja.
Unscheinbarer Alleskönner: Die Ackerbohne, auch Pferdebohne oder Saubohne genannt
Quelle: picture alliance
Lesen Sie auch
Brand Story
Artenschutz
Er schützt die Riesenfische des Amazonas
Anzeige
Kremer erkannte aber auch, mehr als 80 Prozent der Deutschen wollen keine Gentechnik in ihren Lebensmitteln. Ein Großteil des weltweit gehandelten Sojas ist jedoch gentechnisch verändert, auch das, was in deutschen Futtertrögen landet. Für ihn passte das nicht zusammen. „Eine echte Marktlücke“ ergab sich, sagt er heute.
Im Mittelalter war die Ackerbohne hierzulande eines der wichtigsten Nahrungsmittel, vor allem im Norden. Sie war die einzige Hülsenfrucht, die auch auf salzigen Böden und damit in Küstennähe wuchs. Nach dem Zweiten Weltkrieg begannen die Deutschen, mehr Fleisch, Eier und Milchprodukte zu essen, die Sojabohne trat ihren Siegeszug an – als Tierfutter.
Lesen Sie auch
Ethnologie der Pflanzen
„Ohne Nahrungsmigranten wäre unsere Küche eintönig und fad“
Anzeige
In großen Mengen und zu billigsten Preisen wurde sie zunehmend aus Nord- und Südamerika importiert. Regionale Landwirte konnten mit ihrer Ackerbohne, die noch dazu fast ein Drittel weniger Eiweiß für die Tiere lieferte, bald nicht mehr mithalten.
Aktuell wächst die Ackerbohne, auch Sau-, Pferde- oder Puffbohne genannt, hierzulande wieder auf knapp 60.000 Hektar. Das sind dreimal mehr als vor sieben Jahren, wenn auch weniger als ein Prozent der gesamten Ackerfläche. Ein entscheidender Vorteil: Wie alle Hülsenfrüchte – Leguminosen – braucht sie keine zusätzlichen Stickstoffdünger. Die Pflanzen ziehen sich ihren Stickstoff aus der Luft und binden ihn im Boden. Bis zu 125 Kilogramm pro Hektar, mehr als Soja oder Erbse.
Üppiges Angebot für Insekten
Die Ackerbohne schont also Ressourcen und Gewässer. Sie ist außerdem nützlich für Insekten und Wirbeltiere und damit für die Vielfalt in der Landwirtschaft. Ihre Blüten liefern Honigbienen und Hummeln im Mai und Juni ein üppiges Angebot. Soja steht hingegen für vieles, was falsch läuft in der Landwirtschaft: abgeholzte Regenwälder in Südamerika, riesige Monokulturen, Gentechnik. Inzwischen suchen Verbraucher verstärkt nach regionalem Ersatz zur Importbohne.
Lesen Sie auch
Insektensterben
„Sie müssen nur einen Ort zum Leben finden“
Anzeige
Zum Aufschwung der Ackerbohne hat der Druck beigetragen, Ersatz für die aktuellen Klassiker auf dem Feld zu finden. Insbesondere zum Winterweizen, dem mit 45 Prozent häufigsten Getreide in Deutschland. Im Dürrejahr 2018 waren die Erträge regelrecht eingebrochen, im vergangenen Jahr lagen sie ebenfalls unter dem Durchschnitt – mit starken Unterschieden zwischen den Regionen. Dem Mais machte vor allem ein Schädling zu schaffen, der Maiszünsler.
Eine Möglichkeit, sich den Wetterextremen zu stellen, sei die Risikostreuung, sagt Frank Ewert, wissenschaftlicher Direktor des Leibniz-Zentrums für Agrarlandschaftsforschung in Müncheberg bei Berlin. „Wenn Landwirte ihre Fruchtfolgen erweitern, werden sie immer auch Fruchtarten haben, die an Extremsituationen besser angepasst sind als andere“, sagte er.
Von einem „Wendepunkt“ spricht Herwart Böhm vom Thünen-Institut für Ökologischen Landbau in Schleswig-Holstein. Neben Dürre wirke sich der jahrelange Anbau der gleichen Früchte aus. „Die Systeme sind inzwischen sehr anfällig.“ Pestizide wirkten nicht mehr, weil Resistenzen sich breitgemacht hätten. Bringt man mehr Vielfalt in die Abfolge, so die Idee, werden Schädlinge in ihrem Tun unterbrochen, die Böden geschont. Versuche hatten außerdem gezeigt: Wird zwischen eine Abfolge von Getreide ein Hülsenfrüchtler eingeschoben, erhöht sich der Ertrag beim nächsten Getreide im Schnitt um fast ein Drittel.
Lesen Sie auch
Der Wald-Aufklärer
Warum die Eiche in deutschen Wäldern zum Problemholz wird
Die Konsequenz: Die Bauern machen sich mehr Gedanken über die Fruchtfolge. Langsam beginnen sie, wieder häufiger zwischen den Kulturen zu wechseln, auch mal zu Ungewöhnlicherem zu greifen. Neben der Ackerbohne und anderen Hülsenfrüchtlern wie Lupine oder Erbse sind das etwa Hirse und Hanf. Mancherorts kommen ursprünglich exotische Kandidaten hinzu.
So wachsen die bei Verbrauchern beliebten Kirchererbsen mittlerweile in Deutschland. Oder Fenchel, der lange nur von Südeuropa bis Westasien gedieh. Safran, das teuerste Gewürze der Welt und ursprünglich vor allem im Vorderen Orient verbreitet, sprießt jetzt in Franken. Und selbst Soja ist seit einigen Jahren auf heimischen Feldern eingezogen, vor allem in Süddeutschland.
Die Ackerbohne ist allerdings trotz guter Voraussetzungen benachteiligt, sagt Böhm. Gängige Kulturen auf dem Feld seien bislang „ökonomisch überlegen“, zumindest solange „das System einigermaßen stabil ist“. Wird es in Zukunft noch trockener und deswegen das Problem mit den Schädlingen gravierender, werde die Bohne aufholen – gerade im Vergleich mit der zweiten und dritten Weizenernte in Folge, die meist deutlich niedriger ausfallen. Zudem sei noch „alles auf Soja abgestimmt“, sagt Böhm. „Die Futtermühlen, die Lagerung, die Vermarktung.“ Sich da umzustellen sei ein langwieriger Prozess, dazu mit Risiken verbunden.

Und manchmal verhindert auch die Politik, dass ein eigentlich boden- und artenfreundliches Gewächs mit Potenzial eine Chance bekommt. So dürfen Landwirte bei Leguminosen bestimmte Pestizide nicht mehr verwenden, wenn sie die EU-Förderung dafür bekommen wollen. Seitdem macht ihnen Unkraut auf den Feldern zu schaffen, die Ernten sind gesunken. Zuletzt sind dadurch sogar die Flächen der Ackerbohne leicht zurückgegangen.
Neue Sorten für die Zukunft
Anzeige
All diesen Widrigkeiten zum Trotz – auch die Forschung will helfen, die Bohne attraktiver zu machen. An der Universität Göttingen beschäftigt sich eine Arbeitsgruppe mit der „Züchtungsforschung Ackerbohne“. Neue Sorten sollen höhere Erträge liefern, die Pflanze robuster gegenüber Schädlingen, Krankheiten und Trockenheit und verträglicher für Nutztiere machen. Im vergangenen Jahr präsentierten die Wissenschaftler die Sorte Abo-Vici, „Abo minus Vici“ gesprochen, die weniger Vicin und Convicin erhält.
Beide Stoffe bereiten manchen Schweinen und Hühnern Probleme. Bei Menschen, denen ein bestimmtes Enzym fehlt, können sie außerdem zur sogenannten Bohnenkrankheit mit Kopfschmerzen und Übelkeit führen, in Ausnahmefällen sogar zu einer lebensbedrohlichen Blutarmut. Lebensmittelchemiker arbeiten zusätzlich an Verfahren, die die kritischen Stoffe bei der Verarbeitung vollständig entfernen.
Hier können Sie unsere WELT-Podcasts hören
Wir nutzen den Player des Anbieters Podigee für unsere WELT-Podcasts. Damit Sie den Podcast-Player sehen können und um mit Inhalten aus Podigee und anderen sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir Ihre Zustimmung.
Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen dazu finden Sie
hier
.
Agrarexperte Böhm wirbt dafür, bei den Hülsenfrüchten nicht nur auf die Ackerbohne zu schauen. Die wachse ja nur im Nordwesten des Landes mit seinem kühl-feuchteren Klima. Andernorts eigneten sich eher ihre Verwandten mit ähnlich guten Eigenschaften. Im Nordosten, auf den sandigen Böden, sei es die Lupine. Auf lehmigeren Böden eher die Erbse. Im Süden und Rheintal dagegen Soja, der es im Norden zu kalt sei.
Karl-Adolf Kremer bleibt bei seiner dicken Bohne. Sogar einen Verein hat er gegründet, den Rheinischen Ackerbohne e.V. Mit dem will er sich vor allem dafür einsetzen, die Pflanze als mehr als nur als Tierfutter zu betrachten. Eine „neue Wertigkeit“ schwebt ihm vor. Veggieburger, Mayonnaise, Proteinshakes – da liegt aus seiner Sicht ihre Zukunft. Vor 100 Jahren, erklärt er, habe der Verbrauch an Hülsenfrüchten hierzulande noch bei etwa 20 Kilo jährlich gelegen. Heute seien es 500 Gramm. „Wir brauchen mehr einheimisches Eiweiß“, sagt er. Natur und Klima wäre damit geholfen.
Hintergrund: die mediterrane Arzneipflanze Fenchel
Fenchel gedieh lange Zeit nur in milderen Klimazonen. Deutschland war zu kalt
Quelle: De Agostini via Getty Images
Vor allem dort, wo die Bodenpreise hoch und die Erträge niedrig sind, lohnt der Anbau von Fenchel. In den sandigen Böden Nordrhein-Westfalens und Niedersachsens etwa. Dann muss man mit jeder Pflanze viel verdienen, damit Ausgaben und Einnahmen stimmen. Gewürz- und Arzneipflanzen sind dafür geeignete Kandidaten.
Fenchel ist eine inzwischen weltweit verbreitete Gemüse-, Gewürz- und Heilpflanze. Hierzulande, so erzählen Landwirte, rentiert sich vor allem Foeniculum vulgare, der Körnerfenchel, der in die Pharmaindustrie wandert und dort etwa für Verdauungs- und Erkältungspräparate zum Einsatz kommt. Dann müssen höchste Qualitätsstandards eingehalten, dürfen nur wenige Chemikalien eingesetzt, die Felder sorgsam bearbeitet werden. Anders als bei Mais und Weizen muss man „nah an der Pflanze dran sein“, wie Landwirte es nennen. Beim Tee oder Tierfutter, wo weniger strenge Kriterien herrschen, können hiesige Betriebe oft nicht mit der billigen Konkurrenz aus Asien mithalten.
Eigentlich kommt der Fenchel aus dem Mittelmeerraum, braucht Wärme und pralle Sonne. Vor rund 30 Jahren wurde er erstmals in Deutschland angebaut, zunächst im Süden, insbesondere in Franken. Seit zehn Jahren macht er sich auch im Norden besser. Vor allem, seitdem hier die Vegetationszeit früher beginnt und später im Jahr aufhört, die Pflanzen also mehr Zeit zum Wachsen haben. Fenchel hat mit seinen tiefen Wurzeln einen entscheidenden Vorteil gegenüber vielen anderen Kulturen: Er kann mit Dürre besser umgehen. Damit ist in der Zukunft häufiger zu rechnen.
Zu schade zum Rauchen: Hanf
Eine Hanfpflanze mit den charakteristischen fächerartigen Blättern
Quelle: Getty Images
Unter den nachwachsenden Rohstoffen gehört Hanf zu den „Materialien der Zukunft“. Die Pflanze ist genügsam, braucht kaum Pestizide, Dünger und Wasser. Hanf ist regional und vielseitig verwendbar, etwa als Dämmstoff beim Hausbau, als Mittel gegen Entzündungen oder als Alternative zur wasserverbrauchenden Baumwolle. Selbst die Autoindustrie zeigt Interesse. Zwar ist die Hanfanbaufläche in Deutschland mit rund 4500 Hektar noch klein, aber fast neunmal größer als noch vor zehn Jahren. Die Pflanze, so die Vision, könnte auf kargen Böden wachsen, wo andere verkümmern oder deutlich mehr Pflege bedürfen.
Anzeige
Dennoch: Nutzhanf will in Deutschland nicht recht in Schwung kommen. Lutz Klimpel, Professor für Betriebswirtschaftslehre an der Hochschule Merseburg, hat seine Chancen untersucht. Dem Hanf, sagt er, mache vor allem „sein Image“ zu schaffen. Die meisten glaubten, es gehe um den Wirkstoff THC. Sprich, ums Kiffen.
Im Gegensatz zum Rauschhanf enthält der Nutzhanf kaum THC. Von außen lassen sich jedoch beide Varianten nicht unterscheiden. Das sorgt für Auflagen und Vorbehalte. Nutzhanf fällt ebenfalls unters Betäubungsmittelgesetz, auf dem Acker werden Pflanzen zerstört oder geklaut. Selbst die EU-Agrarförderung, die andere Nutzpflanzen erhalten, bekommt er nicht. Und das Saatgut muss jedes Jahr aufs Neue teuer gekauft werden.
Lesen Sie auch
Drogenpolitik
Wie die „Jagd auf Kiffer“ Millionensummen verschlingt
Die Situation ist vertrackt. Die Industrie wartet darauf, dass mehr Hanf angebaut wird, um im größeren Maße planen zu können. Die Bauern kämpfen mit den Auflagen und hoffen auf mehr Nachfrage. Keiner traut sich, das Risiko in Kauf zu nehmen.
Ältestes Getreide der Welt: Hirse
Hirse kommt mit wenig Wasser und kargen Böden aus
Quelle: picture alliance / Zoonar
Lange gab es für Landwirte keinen Grund, hierzulande Hirse anzubauen. Der Ertrag beträgt nur die Hälfte dessen, was Weizenanbau schafft. Im Vergleich zu Mais werden 75 Prozent erreicht. Ein weiteres Manko für Verbraucher: Hirse fehlt das Klebeeiweiß Gluten. Brot und Kuchen lassen sich damit nicht so einfach backen.
Doch das änderte sich in den vergangenen Jahren. Seit Wassermangel zum Problem für heimische Felder wird, erlangt auch die Hirse, das älteste Getreide der Welt, neue Attraktivität. Um ein Kilo trockene Hirse zu gewinnen, braucht es 250 Liter Wasser. Beim Mais sind es 50 Liter mehr, beim Weizen sogar doppelt so viel. Ein wichtiges Argument für Bauern in den trockensten Regionen Deutschlands, darunter in Franken und Brandenburg. Die Anbaufläche ist hierzulande mit geschätzten 2000 Hektar verschwindend gering. Dennoch gilt Hirse als besonders robust gegenüber Schädlingen und als aussichtsreiches Getreide für karge, sandige Böden.
In Zukunft, gibt Frank A. Ewert vom Leibniz-Zentrums für Agrarlandschaftsforschung in Müncheberg, zu verstehen, solle man besser auf ertragsärmere Sorten setzen, als die Ernte ganz oder in großen Teilen zu verlieren. Laut Welternährungsorganisation FAO werden die Unterschiede in den Erträgen umso geringer, je trockener die Jahre sind. Zudem lässt sich durch Züchtung bei der Hirse noch einiges rausholen.
Aktuell ist vor allem die Rispenhirse im Blickfeld. Sie eignet sich wegen ihres hohen Gehalts an Methionin, einer wichtigen Aminosäure, besonders gut als Eiweißzulage in Tierfutter – und könnte damit Soja zum Teil ersetzen. Ewerts Prognose: Die Hirse wird vorrangig in den Trog, nicht auf den Teller wandern. Ein bisschen noch in die Biogasanlage, als Alternative zum Mais. Im Supermarkt werde sie „einfach noch zu wenig nachgefragt“, auch wenn sie besonders gesund ist. Das könnte sich ändern: Glutenfreie Zutaten erfreuen sich zunehmender Beliebtheit.
An dieser Stelle finden Sie Inhalte von Drittanbietern
Um mit Inhalten von Drittanbietern zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir Ihre Zustimmung.
Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen dazu finden Sie
hier
.