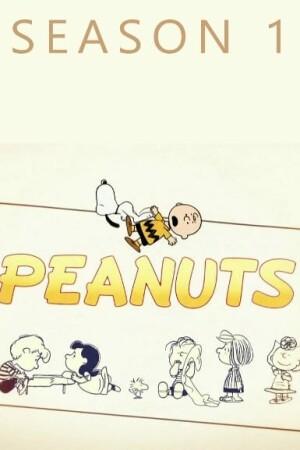Anzeige
+++ Lesen Sie auch: Teil 1 des Tagebuchs von Henryk M. Broder +++
Tag 11
Seltsam, ich kenne fast alle Soaps und Reality-Shows, die im amerikanischen Fernsehen gezeigt werden. Die amerikanische Version der RTL2-Serie "Das Messie-Team“ läuft unter dem Titel " Hoarders “; "Frauentausch“ heißt " Wife Swap “, aus "Einsatz in vier Wänden“ wurde " Extreme Makeover “.
Offenbar haben die Amis überhaupt keine Skrupel, anderer Leute Ideen zu Geld zu machen. Bis jetzt habe ich nur eine Reality-Show gesehen, die in den USA entwickelt wurde: "Extreme Couponing“. Und die ist in der Tat so amerikanisch wie Cola, Cornflakes und Cowboys.
Anzeige
Jeder Zeitung in den USA, von der " New York Times “ bis zum " Poughkeepsie Journal “, liegt am Sonntag ein Stapel Kataloge und Prospekte bei. Die bestehen ihrerseits zum großen Teil aus Coupons, die zum Einkauf von Lebensmitteln und Haushaltswaren bestimmt sind. Bei Vorlage eines Coupons bekommt man drei Dosen Katzenfutter für den Preis von einer. Oder einen Dollar zurück, wenn man sich für die Haferflocken einer bestimmten Marke entscheidet.
Ich entsorge die Prospekte und Kataloge sofort nach dem Kauf der Zeitung, zusammen mit dem Sportteil und der Buchbeilage. Coupon-Profis machen es umgekehrt, sie werfen die Zeitung weg und behalten die Kataloge und Prospekte. Sie wühlen auch die Mülltonnen ihrer Nachbarn durch, denn die bunten Broschüren sind bares Geld wert.
" Extreme Couponing “ begleitet Coupon-Sammler zum Shoppen, die aus der Discount-Idee eine Lebensphilosophie gemacht haben. Sie schneiden die Coupons aus, sortieren sie in Mappen und kaufen strategisch sein, je nachdem in welchem Geschäft welche Artikel gerade angebotenen werden. Die besten unter den Coupon-Profis schaffen es, für Hunderte von Dollar "einzukaufen“, ohne einen einzigen Dollar an der Kasse zu lassen, manche kriegen sogar noch was raus.
Anzeige
In ihren Kellern und Garagen stapeln sich die Waren bis zur Decke – Konserven, Windeln, Tütensuppen, Waschpulver, Tierfutter, Toilettenpapier, Putzmittel, Shampoo, Kekse, Tampons, Schreibwaren, Spielzeug und Schokolade. Voller Stolz führen sie ihre Vorräte vor, mit denen sie jeden Krieg überleben könnten, was sie freilich nicht davon abhält, immer wieder auf Jagd zu gehen. "Ich hab das Couponing im Blut“, sagt eine Haufrau. Eine andere bringt Anfängerinnen den richtigen Umgang mit Coupons bei .
Über drei Milliarden Coupons wurden 2010 eingelöst, ein Zuwachs von 23 Prozent gegenüber 2009. Was wäre, frage ich mich, wenn es alle machen würden? Würde das System kollabieren? Wäre die Konsumgesellschaft am Ende? Ist das Couponing vielleicht der erste Schritt zur Abschaffung des Geldes?
Ich bin von der Coupon-Idee dermaßen angetan, dass ich alles für möglich halte. An der Ecke Liberty/North Street fällt mir eine Reklametafel auf: "Math Lesson – Free QC Coupon“. Kann man jetzt auch Mathematikstunden mit Coupons bezahlen? QC bedeutet Quality Choice.
Anzeige
Der Laden hinter der Reklametafel ist eine Apotheke. Ich gehe rein und frage, wie das so mit dem Nachhilfeunterricht gedacht wäre. Die Apothekerin schaut mich an, als hätte ich sie um eine Familienpackung Ecstasy gebeten. Dann drückt sie mir ein "Coupon Book“ in die Hand. Wenn ich all die Coupons einlöse, habe ich 300 Dollar gespart. Das sei die "Math Lesson“.
Noch etwas? Ja, eine Dose Ibuprofen. Ich sollte die 100er-Packung für 5,99 Dollar nehmen, sagt die Apothekerin, die sei schon um einen Dollar herabgesetzt, und wenn ich zwei nehme, müsste ich auch nur 5,99 Dollar bezahlen. "Buy one, get one free“, mit einem Coupon. Das ist noch nicht "Extreme Couponing“, aber doch ein viel versprechender Anfang.
Tag 12
In "Perkins Family Restaurant“ können Kinder in Begleitung eines Erwachsenen kostenlos essen, immer mittwochs und samstags nach 15 Uhr. Am Dienstag bekommen Senioren den ganzen Tag 20 Prozent Rabatt. Bei Perkins hat man ein Herz für Kunden. Die Angestellten müssen für sich selber sorgen: Ashley hat Fieber, bekommt kaum Luft und würde am liebsten heimgehen. Aber der Boss hat gesagt, sie müsse ihre "Shift“ zu Ende bringen.
Ashley hat eine Lungenentzündung, der Arzt hat ihr Penicillin verschrieben und dafür 50 Dollar berechnet. Mehr war nicht drin, denn Ashley hat keine Krankenversicherung. Sie kann es sich nicht leisten, die Arbeit hinzuschmeißen, schon gar nicht, seit ihr Freund seinen Job bei einer Straßenbaufirma verloren hat. Jetzt sitzt er zu Hause, während Ashley bei "Perkins“ kellnert. Obwohl sie eine Lungenentzündung hat und sich kaum auf den Beinen halten kann.
Ashley ist 22. Als sie drei war, hat der Vater die Familie verlassen. Mit 18 wurde sie von der Mutter vor die Tür gesetzt. Seitdem kämpft sie sich durchs Leben. Verwandte, die ihr helfen könnten, gibt es nicht. Oder sie sind selber arm.
So wie die 46,2 Millionen Amerikaner, die unterhalb der "Armutsgrenze“ leben . Die wird in den USA anders als in Deutschland berechnet, nicht prozentual zum Durchschnittseinkommen, sondern in absoluten Zahlen. Für eine vierköpfige Familie waren es im letzten Jahr 22.314 Dollar, für eine Einzelperson 11.139 Dollar. Aber davon kann kein Mensch leben, nicht einmal eine Mutter, deren Kinder sich jeden Mittwoch und Samstag in "Perkins Family Restaurant“ satt essen können.
Tag 13
"Du musst dir Titusville ansehen“, sagt Jochen, "das war mal eine wichtige Stadt in der amerikanischen Geschichte.“ Ein Mann namens Edwin Drake kam im Jahre 1859 auf die Idee, bei Titusville, wo bis dahin vor allem Holz verarbeitet und umgeschlagen wurde, nach Erdöl zu suchen. Er stieß auf eine Blase in nur 20 Meter Tiefe.
Anzeige
Das war die Stunde null eines neuen Zeitalters, für Pennsylvania eine historische Zäsur wie der Bau der ersten Eisenbahnlinie von Nürnberg nach Fürth im Jahre 1835 für Bayern. 1881 wurde in Titusville die erste Ölbörse der Welt etabliert. Die Stadt boomte, bis das Öl langsam zur Neige ging und die Förderung zu teuer wurde. Heute werden noch immer jedes Jahr ein paar Barrel Öl produziert, in kleine Flaschen abgefüllt und an Touristen verkauft.
Ich mache mich also auf den Weg nach Titusville, komme aber nicht weit. Ein paar Meilen hinter Guys Mills steht am Straßenrand das Auto, baugleiches Modell von jenem, mit dem Bonnie und Clyde von einem Banküberfall zum nächsten rasten, ein Ford Town Car, Baujahr 1930. Der Wagen sieht aus, als wäre er gerade vom Fließband gerollt.
Ich stelle meinen albernen kleinen Kia ab und schaue mir das antike Prachtstück von allen Seiten an. Es steht zum Verkauf und soll nur 8500 Dollar kosten! "Wanna buy?“, ruft mir ein Mann zu, der gerade den Rasen mäht. Es ist Bob, dem das fliederfarbene Auto und das weiße Haus dahinter gehören.
Bob ist über 70, hat viele Jahre in einer Fabrik in Erie als Mechaniker gearbeitet und fühlt sich "zu jung, um auf der Veranda zu sitzen und Fliegen zu klatschen“. Den Ford hat er vor Jahren gekauft, nach und nach restauriert und will ihn nun verkaufen, weil er den Platz in der Garage braucht.
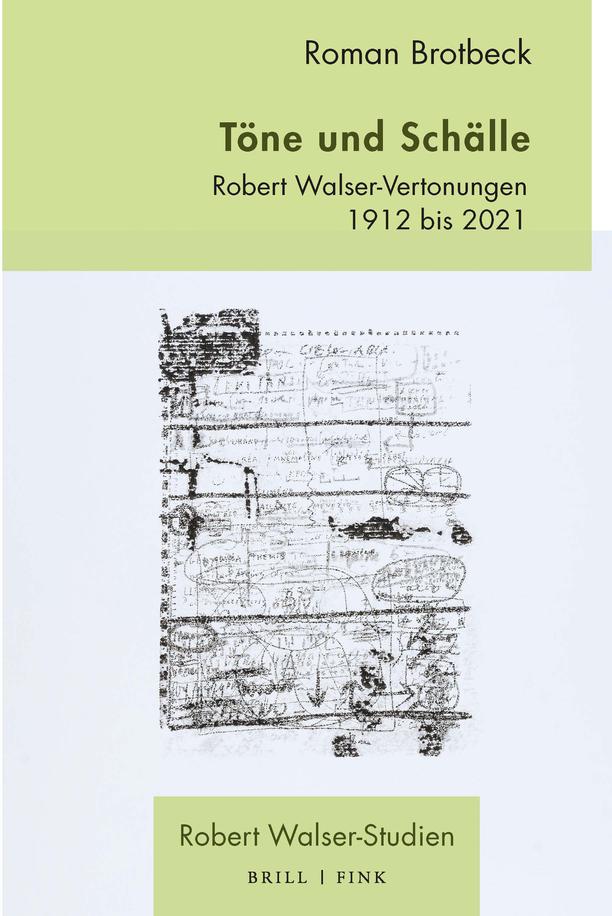
Das Auto ist in einem Top-Zustand, man könnte damit sofort losfahren, unter der Motorhaube wartet ein Vier-Zylinder-Boxermotor auf ein Signal vom Anlasser. Ein Salon auf vier Rädern, bequem und geräumig. "Nur nicht so flott wie früher“, sagt Bob. "Mit 80 braucht jeder mehr Zeit, vor allem, wenn es bergauf geht.“ Mit einem solchen Auto bei "Einstein“ in Berlin Unter den Linden vorzufahren, das wäre eine Sensation. Muss mich morgen gleich nach den Frachtraten erkundigen.
Die Amerikaner stehen im Ruf, alles wegzuwerfen, was sie nicht brauchen. Tassen und Teller, die älter als zehn Jahre sind, gelten schon als Antiquitäten. Aber wenn es um Autos geht, werden sie sentimental. Jack, der mit seinem Sohn Jim an der Route 27 eine Autoreparaturwerkstatt betreibt, bringt es nicht übers Herz, ein verlassenes Auto, das irgendwo vor sich hin gammelt, stehen zu lassen.
So wie andere Leute alte Pferde vor der Notschlachtung retten, so rettet er alte Autos. Zuletzt einen Nash Metropolitan und einen Buick Wildcat aus den 50er- beziehungsweise 60er-Jahren. Der Wildcat ist ein Riesendampfer, der Metropolitan ein Schiffchen. Er wurde in den USA konstruiert, in England gebaut, galt als nicht sehr verlässlich, aber ungemein sexy, weil der Innenraum so eng und kuschelig war. Schon beim Gangwechsel kam man sich näher.
Heute ist er so selten wie eine original Wurlitzer Jukebox aus den 50er-Jahren. Über den Wildcat lässt Jack gar nicht mit sich reden, und für den Metropolitan will er einen Preis, der jenseits der Schmerzgrenze liegt. Ich steige in meinen Koreaner und rolle weiter.
Anzeige
Kurz vor Titusville fahre ich an einer Holzscheune vorbei, an der eine US-Fahne im Wind flattert. Auch die Scheune sieht aus, als würde sie hin und her schwanken. Die Tür und die Fenster sind vergittert; mein Koreaner kann inzwischen Gedanken lesen, macht einen U-Turn und hält vor dem Schuppen.
Ich steige vier Stufen hoch, mache die Tür auf und stehe in einem Tante-Emma-Laden für Waffenliebhaber . Auf der Theke liegt das "Blue Book of Gun Values“, 2300 eng bedruckte Seiten, die Bibel der Waffensammler. Hinter der Theke sitzt ein Mann, der wie ein Verwandter von Fozzie Bär aus der "Muppet-Show“ aussieht: Don. Der Laden gehört ihm, er hat ihn von seinem Vater geerbt.
Schon als Junge habe er sich für historische Waffen interessiert. Sein Lieblingsstück ist eine kleine Smith & Wesson aus dem Jahre 1855. Mit einem Revolver dieses Typs wurde Abraham Lincoln erschossen. Die Revolver der Marke Rough Rider, hergestellt von der Firma Heritage in Florida, sind dagegen Replikas, es gibt sie mit kurzem und mit langem Lauf, mit Griffen aus Holz oder Perlmutt.
Seine Oma, sagt Don, war eine entfernte Verwandte von Jesse James; dann erklärt er mir, unter welchen Bedingungen man in Pennsylvania Waffen besitzen kann. Man muss 21 Jahre alt und darf nicht vorbestraft sein. Dann bekommt man vom örtlichen Polizeichef eine "license“, die auch in elf anderen US-Staaten gilt, mit denen Pennsylvania ein "Abkommen auf Gegenseitigkeit“ geschlossen hat. Dazu zählen auch Alaska, Florida, Georgia und Texas, mit denen Pennsylvania keine gemeinsame Grenze hat.
Ich frage mich, wie man mit einer Waffe im Gepäck von Pennsylvania nach Texas kommt, ohne gegen die Gesetze der dazwischenliegenden Staaten zu verstoßen. Die Antwort darauf könnte ein Minirevolver von North American Arms sein, die vermutlich kleinste Handfeuerwaffe der Welt, kleiner als ein Flip-Phone, man könne damit "keine Bären jagen“, sagt Don, sonst aber sei der "Mini“ eine „ernst zu nehmende Waffe“, vor allem für denjenigen, auf den sie zielen würde. Und mit 250 Dollar sehr preisgünstig.
Es ist schon später Nachmittag, ich habe mich mit Bob, Jack und Don verschwatzt. Nach Titusville sind es nur noch ein paar Meilen. Ich parke in der West Spring Street, vor dem "Titusville Herald“, gegründet 1865, schräg gegenüber dem "Perk Place Café“, einem Diner. Ich bin der einzige Gast, für Lunch ist es zu spät, für Dinner zu früh.
Anzeige
Ich setze mich an die Bar, bestelle ein Shrimp-Sandwich, einen gemischten Salat und einen Tee. "No problem“, sagt die Bedienung. Sie sieht sehr jung aus. Zehn Minuten später weiß ich alles über Capri. Sie ist 21, hat italienische, irische und haitianische Vorfahren, einen achtjährigen Sohn, arbeitet im "Perk Place Café“, im CVS-Drugstore als Verkaufshilfe und an Wochenenden als DJ. Sie würde gerne auf ein College gehen, am liebsten in Kalifornien, da sei mehr los und das Wetter besser als in Pennsylvania.
Für die Rückfahrt nach Allegheny brauche ich genau 30 Minuten. Jochen will wissen, wie es mir in Titusville gefallen hat. "Sehr gut“, sage ich, "aber ich habe kaum was gesehen, war zu viel los unterwegs.“
Tag 14
Wenn man die Kultur eines Landes nicht an der Zahl der mit öffentlichen Mitteln subventionierten Opernhäuser misst, sondern am Zustand der öffentlichen Toiletten, dann liegen die USA ziemlich weit vorne.
Das beliebteste Verkehrsmittel, um von A nach B zu kommen, ist immer noch das Auto. Von Pittsburgh nach Washington DC zum Beispiel sind es nur 191 Meilen oder 307 Kilometer. Man könnte mit dem Zug fahren, wenn es nicht nur zwei Verbindungen gäbe, eine um 4.30 Uhr und eine um 6.30 Uhr.
Wobei demotivierend dazukommt, dass der Bahnhof von Pittsburgh in einer Gegend liegt, in der man nicht unbedingt im Morgengrauen auf den Zug warten möchte. Außerdem dauert die Zugfahrt acht Stunden. Man könnte auch fliegen, aber für den Preis eines Tickets von Pittsburgh nach Washington bekommt man schon ein Ticket nach London oder Los Angeles . Also nehme ich das Auto.
Autobahnfahren in den USA ist nicht immer ein Vergnügen, aber nie so anstrengend wie in Deutschland, weil weitgehend stressfrei. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit liegt bei 65 Meilen pro Stunde, das sind gerade mal 105 km/h.
Das Beste am Autofahren aber sind die "Rest Areas“, sie haben mit unseren Raststätten wenig gemein. Zum einen werden sie von der Verkehrs- oder Tourismusbehörde unterhalten, zum anderen ist der Service kostenlos. Fürs Pinkeln einen Dollar zu bezahlen käme einem Amerikaner absurd vor. Dennoch oder deswegen sind die "Restrooms“, wie man in den USA die Toilettenanlagen verschämt nennt, so blitzsauber, als wären sie nur zum Vorzeigen und nicht zum Benutzen da. Keine Ahnung, wie die das schaffen.
Außerdem gibt es richtige Spielplätze für Kinder, Picknickareale und Grünanlagen für die Bedürfnisse der mitreisenden Hunde. Alles klar beschildert, denn die Amis tun nur so, als wären sie wilde Offroader, in Wahrheit sind sie Ordnungsfanatiker.
Und das Beste an den "Rest Areas“ sind wiederum die "Welcome Center“. Da liegt ein Sortiment an Broschüren bereit über die "Attractions“ zu beiden Seiten des Highways. Hotels, Shopping-Malls, historische Sehenswürdigkeiten, Festivals und Kuriosa, die man nicht verpassen sollte. Straßenkarten gibt es kostenlos. Und eine Beratung, falls jemand wissen möchte, wo George Washington oder Michael Jackson mal übernachtet haben.
Es sind vor allem Senioren, die im "Welcome Center“ als Berater arbeiten, Freiwillige, die sich sonst zu Hause langweilen oder ihren Angehörigen auf die Nerven fallen würden. Wie Michael und Helen, 77 und 75 Jahre alt, die an drei Tagen der Woche zum Dienst antreten.
Sie bitten die Besucher, sich in das Gästebuch einzutragen. Und wenn sie dann entdecken, dass der Besucher aus "Germany“ kommt, geraten sie ins Schwärmen. Ja, da seien sie vor vielen Jahren auch mal gewesen. "Nice people, good food“, am besten habe ihm das "German beer“ geschmeckt, sagt Michael, viel besser als das amerikanische. Nur die "Restrooms“, erinnert sich Helen, die seien "nicht so gut“ gewesen.
Tag 15
Brooklyn, Union Street zwischen der 6. und 7. Avenue. Eine Wache der New Yorker Feuerwehr. Über dem Tor ein Transparent: "We will not forget them – God bless America“. Gleich links neben dem Tor eine drei Meter hohe Holzskulptur zu Ehren der 343 New Yorker Feuerwehrleute , die am 11. September 2001 ums Leben gekommen sind.
Ein Mann aus Oregon hat die Skulptur mit seinem Pick-up nach New York gebracht und vor der Wache abgeladen, ein Pizzabäcker aus dem Viertel die Twin Towers aus Blumen gebaut. Auch wenn sie verwelkt sind, wird die Erinnerung daran, was an 9/11 geschah, nicht vergehen. 24 Feuerwehrmänner der Squad Co. 1 waren im Dienst. 12 von ihnen haben den Tag nicht überlebt.
+++ Lesen Sie auch: Teil 1 des Tagebuchs von Henryk M. Broder +++